Gastarbeiterin Arzije Asani zog als Teenager in die «Jugo-Blöcke» an der Steinackerstrasse. Jahre später kehrt sie mit gemischten Gefühlen an den Ort zurück.
Wenn ich meine Eltern im Dorf besuchen gehe, fahre ich immer an den Blöcken vorbei, in denen wir vor Jahren gewohnt haben. Sie stehen ziemlich am Rand des Dorfes. Oder ist es der Anfang? Es wirkt, als wären sie ausgegrenzt worden, oder lassen ihnen die Dorfbewohner*innen ihren Raum?
In der siebten Klasse teilten mir meine Eltern mit, dass wir an die Steinackerstrasse ziehen würden. «Was? Zu den Jugo-Blöcken?!», riefen meine Geschwister empört. Ich freute mich im Stillen, denn ich wusste, dass eine meiner engsten Freundinnen und viele andere Albaner*innen aus der Schule dort wohnten. Vielleicht würde ich mich jetzt endlich auch irgendwo zugehörig fühlen?
Als der Klassenlehrer meiner Schwester erfuhr, dass wir dorthin ziehen würden, fragte er meine Mutter ungläubig, warum wir denn in so einer unordentlichen Siedlung wohnen wollten. Meine Mutter antwortete, dass dies kein Problem sein sollte. Wir Kinder gingen alle schon zur Schule. Integriert hätten wir uns bereits. «Wen interessierte es schon, was sie sagten? Ich hatte ganz andere Sorgen», erklärt mir meine Mutter auf die Frage hin, ob sie der Ruf der Siedlung nicht abgeschreckt habe.
Vielleicht würde ich mich jetzt endlich auch irgendwo zugehörig fühlen?
Wir zogen direkt einen Block neben dem meiner Freundin. Die Wohnung war in viel besserem Zustand als unsere vorherige, doch auch in dieser Wohnung entdeckten wir später Schimmel im Badezimmer. Wenn es mal passierte, dass ich mich alleine in der Wohnung befand, setzte ich mich draussen auf den weissen Balkon und lauschte den Gesprächen unserer Nachbar*innen. Irgendwie fühlte ich mich dabei aufgehoben.

Meine Freundin, mit der ich heute noch gut befreundet bin, besuchte eine andere Klasse als ich, doch unser Weg zur Schule war derselbe. An warmen Tagen stiegen wir jeweils zu zweit aufs Fahrrad. Sie war viel sportlicher als ich und trat kräftig in die Pedale. Ich sass auf dem Gepäckträger. Es war zwar verboten, zu zweit aufs Fahrrad zu steigen, doch dies waren die wenigen Momente, in denen es mir egal war, was die Leute aus dem Dorf sagten. Ich genoss diese Zeit, in der ich ich selbst sein konnte, bevor ich wieder in ein Klassenzimmer voller kritischer Blicke treten musste.
In der Schule grinsten sie, wenn ich ihnen erzählte, dass ich nun an der Steinackerstrasse wohnte. «Die Jugo-Blöcke sind schon ein kleines Ghetto, gell?», fragten sie mich, ohne jemals da gewesen zu sein. Ein Ghetto war dieser Ort nicht. Es war ein Ort mit Leuten, die das gleiche Schicksal teilten. Einwanderer*innen aus verschiedenen Ländern von der ganzen Welt, mit der Hoffnung, hier ein sicheres Leben führen zu können. Menschen, die sich unten in der Wäschekammer oder auf den Parkplätzen ab und zu in die Haare gerieten, sich untereinander aber aushalfen, wenn eine Familie etwas brauchte. «Ich erinnere mich an eine dieser drei Schwestern, die alle in der Siedlung wohnten», erzählt mir meine Mutter. «Sie übertrug mir damals einen ihrer Waschtage, weil ich fünf Kinder hatte und sie nur eines.»
«Die Kinder aus den Jugo-Blöcken können nicht richtig Deutsch und sind schlecht in der Schule!»
Die Kinder aus der Siedlung spielten jeden Tag und bei jedem Wetter draussen auf der grünen Wiese, die inmitten dieser Blöcke lag. Sie spielten Fussball, manchmal auch auf der abgebrochenen Rutschbahn, die oft monatelang so da lag. Wenn man ihnen zuhörte, konnte man viele verschiedene Sprachen erkennen, oft durchmischt in einem einzigen Satz. «Die Kinder aus den Jugo-Blöcken können nicht richtig Deutsch und sind schlecht in der Schule!», hiess es im Dorf, doch in dieser Siedlung verurteilten sich die Kinder nicht aufgrund ihrer Sprachen.
Wenn Bajram anstand, kamen die gleichen Kinder von der Wiese an unserer Türe klingeln und wollten Süssigkeiten. Wie an Halloween, nur dass eben Bajram war. «Früher, im Kosovo, machten wir das auch so», erzählte mir dann mein Vater. «Wenn ich das als Kind nur gewusst hätte», dachte ich mir damals, «dann wäre ich als Kind auch um die Häuser gezogen». Doch dann merkte ich, dass dies in der vorherigen Strasse gar nicht möglich gewesen wäre. Denn die alte Wohnung stand in einer Strasse umgeben von Schweizer Familien, die ich zwar sehr nett in Erinnerung habe, die aber nicht die gleichen Traditionen pflegten.
Zum ersten Mal im Leben fühlte ich mich unbeobachtet.
An der Steinackerstrasse war es vielleicht nicht möglich, perfekt Deutsch zu lernen, doch ich bekam die Möglichkeit, mich der Kultur meiner Eltern zu nähern und zu spüren: es ist okay, albanisch zu sein. An diesem Ort konnte ich einfach ich selbst sein, ohne immer den Druck zu verspüren, nicht aufzufallen, mich anpassen zu müssen, möglichst schweizerisch zu sein. Obwohl ich mich durch die Blicke hinter den Vorhängen hätte beobachtet fühlen müssen, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben unbeobachtet.

Im Alter von 15 Jahren begann ich dann, die Mittelschule zwei Dörfer weiter zu besuchen. Meine Freundin von nebenan hatte einen anderen Weg eingeschlagen, wir sahen uns aber trotzdem täglich. Jedes Mal nach der Schule machte ich einen Halt bei ihrem Block. Meine Eltern wussten damals nichts davon. Ihre Wohnung war kleiner als unsere. In ihrem schmal geschnittenen Zimmer setzten wir uns auf den Boden neben ihrem Bett und hörten uns traurige Lieder von Lykke Li an. «I follow rivers» sangen wir leise und liessen unsere pubertierenden Emotionen freien Lauf. Manchmal, wenn ihr Vater nicht zu Hause war, setzten wir uns mit ihrer Mutter ins Wohnzimmer, die uns dann immer Neuigkeiten aus der Siedlung erzählte. Und wenn uns sehr langweilig wurde, wurden wir zu jenen Menschen, die wir eigentlich schrecklich nervig fanden: Wir beobachteten die Leute, die sich draussen aufhielten, und trafen manchmal auf andere Augenpaare, die sich hinter den Vorhängen versteckten.
Ich verspüre ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich daran vorbeifahre.
Nach fünf Jahren entschieden sich meine Eltern wegzuziehen, da die Nebenkosten zu hoch geworden waren. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen. Meine Freundin von nebenan wohnt nicht mehr in der Siedlung. Sie würde niemals dorthin zurückkehren, sagt sie heute, wenn wir uns über die Zeit in der Siedlung unterhalten. Und auch ich verspüre immer ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich daran vorbeifahre.

Ein bisschen ängstlich und nervös entscheide ich mich, die Siedlung nach all diesen Jahren zu besuchen und herauszufinden, wie sich die Bewohner*innen heute fühlen. Zusammen mit meinem Freund fahren wir mit dem Auto dorthin. Die Blicke der Nachbar*innen sind immer noch da. Zu meinem Erstaunen finden wir schnell einen Parkplatz. Früher gab es viel weniger Parkmöglichkeiten. Die Blöcke sind viel kleiner als in meiner Erinnerung. Sie haben jeweils nur drei Stockwerke. Bei den meisten sind die gelben Rollläden hinuntergezogen und bei anderen hängen dichte weisse Vorhänge an den Fenstern.
«Die Ausländer*innen pflegten ihre Wohnungen sehr vorbildlich. Anders als manche Schweizer*innen.»
Frau Sieber, die Verwalterin der Steinacker-Blöcke, begrüsst mich mit einem einladenden Lächeln. Sie war gefühlt schon immer hier und kennt alle Mieter*innen. Die Firma Sieber hatte die Blöcke 1977 zu einem stark ermässigten Preis gekauft und die Wohnungen zu einem tieferen Preis neu vermietet. «Sobald die Ausländer*innen Überhand nahmen und mehr als 50 Prozent der Mieterschaft ausmachten, wollten keine Schweizer Familien mehr in der Siedlung wohnen», teilt mir Frau Sieber mit, während wir die Stufen zu meiner alten Wohnung hinaufsteigen. Den Ruf «Jugo-Blöcke» hat Frau Sieber nicht mitbekommen. «Wir waren nicht traurig darüber, dass keine Schweizer*innen mehr im Steinacker wohnen wollten. Die Ausländer*innen pflegten ihre Wohnungen sehr vorbildlich. Anders als manche Schweizer*innen.»

Wir treten in die alten vier Wände meiner Familie ein und mir fällt sofort auf, wie tief die Decken sind, und wie eng die Wohnung geschnitten ist. Wie konnten wir hier nur zu siebt wohnen? Der kleine weisse Balkon erscheint mir nun winzig, und während ich da stehe, fühle ich mich ausgestellt und unwohl. Die abgebrochene Rutschbahn auf der grünen Wiese ist verschwunden. Nun steht eine Schaukel da. Die Kinder spielen immer noch Fussball. «Das sind alles kleine Shaqiris», sagt Frau Sieber laut und zeigt auf die spielenden Kinder draussen. «Wenn die Schweiz spielt, laufen sie stolz mit Shaqiri- und Xherdan-Shirts herum.»
«Scheidungen gibt es hier im Steinacker nicht.»
Vor zehn Jahren sah ich den kleinen Riad auf dieser Wiese spielen. Heute ist er 19 Jahre alt und arbeitet als Polymech. Er lässt mich und Frau Sieber in seine Wohnung eintreten. Seine Familie wohnt seit 20 Jahren im Steinacker. Frau Sieber erzählt daraufhin, dass alle Wohnungen in der Blocksiedlung vermietet seien. Mehr als die Hälfte der Mieter*innen wohnen seit über zwanzig Jahren in der Siedlung. Meist auch generationenübergreifend. «Viele Jahre vergehen, ohne dass es einen Mieterwechsel gibt, im Vergleich zu unseren anderen Siedlungen im Rheintal. Da gibt es immer wieder eine Scheidung und Mieterwechsel. Scheidungen gibt es hier im Steinacker nicht.»
Riad nickt zustimmend. «Und wenn es Neubezüger*innen gibt, dann sind es meistens Personen aus dem Umfeld der bestehenden Mieter*innen», erzählt Frau Sieber weiter. «Ende der 90er-Jahre, als auf dem Balkan Krieg herrschte, wollte eine serbische Familie hier in den Steinacker ziehen. Das Depot und die erste Miete waren schon bezahlt. Doch die albanischen Familien sind Spalier gestanden und haben eine Initiative ergriffen. Sie wollten diese serbische Familie nicht hier haben. Wir haben dann die Wohnung jemand anderem gegeben.» Riad runzelt die Stirn und fügt hinzu: «Ja, wir sind so etwas wie eine Einheit geworden hier. Heute leben aber schon ein paar serbische Familien in den Blöcken da vorne.»
Riad beschreibt die Siedlung als sehr angenehm. Es sei immer ein bisschen etwas los, man habe immer wieder gute Gespräche mit Nachbar*innen und man kriege nicht so schnell Lärmklagen wie in anderen Siedlungen. Eine sehr lockere Umgebung eben.» Frau Sieber stimmt wieder in das Gespräch ein: «Ja, locker ist das richtige Wort. Wir hatten auch sehr viele Familien, die zurückgekehrt sind, weil sie fanden, hier sei der Umgang der Nachbar*innen noch sehr menschlich.»
«Sie wollen nicht als arm gelten, sonst macht man sie wütend.»
Riads bester Freund wohnt im Block nebenan und mit anderen Freunden aus der Kindheit, die mittlerweile ausgezogen sind, sei er auch immer noch befreundet. «Diese Siedlung ist einfach mein Zuhause. Als Kind konnte ich jeden Tag raus, um Fussball zu spielen und mich mit den anderen Kindern zu vernetzen.» Riad schaut zu Elisabeth Sieber und erzählt weiter: «Eine Zeit lang hatten wir zu wenig Parkplätze. Das war schon ein bisschen anstrengend, denn wir haben zum Beispiel vier Autos.» «Vier Autos?», frage ich ungläubig nach. «Ja, und sie sind nicht die einzigen», fügt Frau Sieber hinzu, «der Wohlstand ist im Steinacker ausgebrochen. Sie sind alle technisch auf dem neusten Stand und haben alle ein Haus auf dem Balkan. Sie wollen nicht als arm gelten, sonst macht man sie wütend.»

«Wenn man bodenständig leben und nicht eine zu teure Miete haben möchte, dann ist es toll hier. So konnten wir unten ein schönes Haus bauen und sind so abgesichert», erklärt Riad. Auf die Frage, ob er für immer hier wohnen wolle, antwortet er: «Ich denke schon, dass ich hierbleiben möchte. Hier kenne ich mich aus. Wenn ich mal Kinder habe, weiss ich, sie würden hier gut aufwachsen, so wie ich. Es würde mir ein Gefühl von Sicherheit geben. Den Ruf Jugo-Blocke hören wir auch immer seltener.»
Wir verabschieden uns von Riad. Beim Hinauslaufen erzählt mir Frau Sieber von den nächsten Schritten in der Siedlung. «Wir werden isolieren und Solarpanel aufstellen. Ich glaube daran, dass die Blöcke noch 30 Jahre bestehen bleiben.»
Gedankenversunken kehre ich nach Zürich zurück. Obwohl ich selbst in dieser Siedlung gelebt habe, hatte ich irgendwann Vorurteile entwickelt und mir das Leben der Bewohner*innen sehr traurig vorgestellt. Doch diese Familien fühlen sich wohl im Steinacker. Sie haben die Siedlung, die einst von der schweizerischen Mittelklasse verlassen worden war, zu ihrem Zuhause gemacht und darin einen sicheren Raum für sich geschaffen. Diese Familien sind angekommen und es ist eine bewusste Entscheidung, dass sie hierbleiben. Vielleicht steht die Siedlung nicht am Rand des Dorfes, sondern am Anfang.

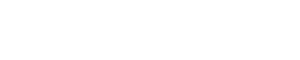

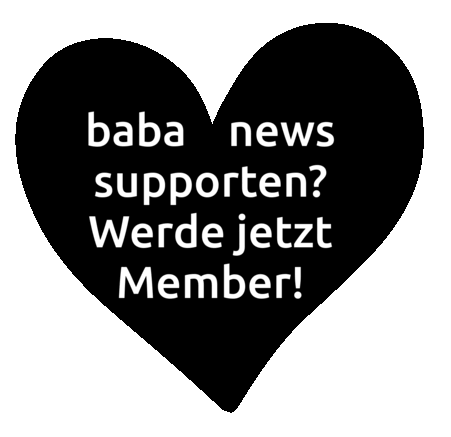
Sehr schöne Geschichte, auch wenn sie die Gettoisierung ein bisschen romantisiert.
Danke Arzije, für diesen bewegenden Beitrag. Ich fühle mich etwas in der Zeit zurück versetzt und muss gestehen einige Erlebnisse und Gefühle ähnlich erfahren zu haben.
Danke Arzije, für diesen tollen und bewegenden Beitrag. Es weckt einige Erinnerungen und Gefühle die ich ähnlich wie du empfunden habe.
Danke für diesen Beotrag. Hat mich selber gleich in meine eigene Kindheit zurückversetzt. Bin auch in einer ähnlichen Siedlung aufgewachsen und habe tolle Erinnerungen daran. Die Freundschaften und das Aufwachsen mit verschiedenen Kulturen hat mich geprägt auf wunderbare Art. Danke für die erweckten Erinnerungen
Ich kann mich stark mit dem identifizieren, das Arzije beschreibt. Die “Ghettos” waren stets Zufluchtsorte für mich und meine gleichgesinnten Freund*innen. Was mich zum Denken anregt, heute 2022, werden all diese genannten “Ghettos” in Zürich und Umgebung (Schlieren, Altstetten, Dietikon usw.) extrem gentrifiziert — und alle schauen nur zu und unternehmen wenig bis nichts dagegen. Viele meiner Freund*innen wurden gezwungen irgendwo ins Aargau, ins Zürcher Oberland oder auch weiter weg, wegzuziehen, weil sich es die Familien nicht mehr leisten konnten dort zu leben.
Na ja ist ein anderes Thema, aber toller Beitrag — mal wieder.
ganz liebe grüsse aus der Baslerstrasse… 😉
Liebe Arzije, auch heute wie immer deine Geschichten, lese ich gerne.
Sind sehr spanend und sind deine.
Hoffe Schreiben die andern auch über Vergangenheit.
Vielen lieben Dank 😘👍