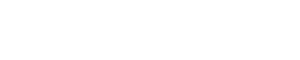Eine Zürcher Staatsanwältin untersucht in einem Verfahren, ob ein SVP-Politiker mit einem Repost gegen den Diskriminierungsartikel verstossen hat – und wird deswegen wegen ihrer kosovarischen Herkunft angegangen. Ein Kommentar über die Debattenkultur der Rechten.
Was ist passiert?
Bei der Zürcher Staatsanwaltschaft befasst sich eine Staatsanwältin gegenwärtig mit der Frage, ob SVP-Politiker Claudio Zanetti mit einem Repost auf X gegen den Diskriminierungsartikel des Strafgesetzbuches verstossen hat.
Der von Zanetti geteilte Post stammt vom israelischen Propagandisten Arye Sharuz Shalicar und zeigt die Abbildung einer zur Faust geformten Israel-Fahne, die eine zum Hakenkreuz geformte Palästina-Fahne zerschlägt. Darüber stehen die Worte: «NIE WIEDER ist JETZT! Komme was wolle.»
Ein Politiker der Grünen hatte Zanettis Repost gesehen und zeigte den SVP-Politiker bei der Staatsanwaltschaft an. Daraufhin eröffnete die zuständige Staatsanwältin ein Verfahren wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Zanetti ging mit dem Verfahren an die Öffentlichkeit und die Medien griffen das Thema dankbar auf.
Es ist nicht das erste Mal, dass Claudio Zanetti aufgrund eines Tweets Diskriminierung vorgeworfen wird. Ironischerweise stand er bereits 2016 in der Kritik, nachdem er einen Tweet eines bekennenden Rechtsextremen geteilt hatte, in dem dieser die antisemitische White-Genocide-Verschwörungstheorie verbreitete.
Nun bekommt der Angeklagte Verstärkung vom SVP-Kollegen Christoph Mörgeli. Dieser meldete sich letzten Mittwoch in der Weltwoche zu Wort, rechtfertigte den Repost und rückte stattdessen die Herkunft der Staatsanwältin ins Zentrum. Denn dass diese «Wurzeln im muslimischen Kosovo» habe, werfe laut Mörgeli «Fragen ihrer juristischen Interpretation der Strafnorm» auf.
Ein Rückblick auf eine Story, die eindrücklich zeigt, wie es um die Meinungsfreiheit migrantischer Menschen steht.
Hintergrund der Strafnorm
Zur Erinnerung: Die Strafnorm gegen Diskriminierung (Art. 261bis StGB) bestraft Personen, die öffentlich zu Hass oder Diskriminierung gegen Menschen «wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion» aufrufen. Sie wurde 1994 von der Stimmbevölkerung angenommen – gegen den Widerstand konservativer Kreise. Die SVP versuchte seitdem mehrmals erfolglos im Parlament, die Norm wieder streichen zu lassen.
Im Weltwoche-Artikel behauptet Mörgeli, der Diskriminierungsartikel sollte ursprünglich Juden schützen. Die beabsichtigte Wirkung ist klar – «proisraelische» Tweets sollen ganz grundsätzlich nicht unter eine Strafnorm fallen können, die zum Schutz von Jüdinnen und Juden gedacht war.
Damit setzt er nicht nur implizit Israel und jüdische Menschen gleich (was an sich als antisemitisch gewertet werden kann) sondern stellt auch den Diskriminierungsartikel falsch dar.
«Proisraelische» Tweets sollen ganz grundsätzlich nicht unter eine Strafnorm fallen können, die zum Schutz von Jüdinnen und Juden gedacht war.
Die Botschaft zur Rassendiskriminierungs-Konvention sagt explizit, dass eine ausdrückliche Benennung des Antisemitismus geprüft und verworfen wurde. Die Bestimmung sollte keinen Unterschied zu anderen Formen der Diskriminierung machen. Die Strafnorm sollte daher von Anfang an Jüdinnen und Juden genauso vor Diskriminierung schützen wie auch Angehörige anderer religiöser oder ethnischer Gruppierungen.
Die Herkunft der Staatsanwältin
Endgültig absurd wird es, als Mörgeli zum eigentlichen Kritikpunkt kommt: Die Staatsanwältin, die die Anzeige gegen Zanetti behandelt, habe familiäre Wurzeln im «muslimischen Kosovo», weshalb ihre Interpretation von Zanettis Pro-Israel-Aufruf Fragen aufwerfe.
Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für rassistische Diskriminierung.
Mörgeli stellt somit die juristische Interpretation der Staatsanwältin aufgrund ihrer Herkunft und damit verbundenen vermuteten Religion infrage. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für rassistische Diskriminierung.
Ziel der Berichterstattung
Zunehmende antimuslimische Berichterstattung in den Medien im Allgemeinen und in der Weltwoche im Besonderen, mag nicht überraschen. Trotzdem sticht der Artikel heraus – die der Öffentlichkeit unbekannte Staatsanwältin wird mit vollem Namen genannt, und ihre Arbeit wird allein aufgrund ihrer Herkunft infrage gestellt.
Der Artikel zielt darauf ab, das Urteilsvermögen der «muslimischen» Staatsanwältin zu diskreditieren. Musliminnen und Muslime und selbst Menschen, welche nur Wurzeln in einem säkularen, muslimischen Land haben, sollen unter Generalverdacht gestellt werden, insbesondere wenn es um Israel geht.
Wer sich diesbezüglich zu offensiv äussert oder handelt, wird medial an den Pranger gestellt. Diese Entwicklung ist zwar wenig überraschend, aber doch besorgniserregend, angestossen wird sie ausgerechnet von den Menschen, die (wenn es um ihre eigene Meinung geht) lauthals nach Meinungsfreiheit rufen. Aber diese Meinungsfreiheit gilt in ihren Augen offenbar nicht für alle Menschen in der Schweiz.
Von Nico Zürcher