Die Diskussion um das Verhüllungsverbot macht antimuslimische Rassismen sichtbar. Diese sind Teil unserer gesellschaftlichen Selbstinszenierung. Ein Beitrag unseres Gastarbeiters Timo.
Ich beginne diesen Text zwar mit der Initiative zum Verhüllungsverbot, hoffe jedoch an einem anderen Ort zu enden. An einem Ort wo klar ist, dass es eine Veränderung in unseren gesellschaftspolitischen Strukturen braucht, sowie eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verstrickung in den antimuslimischen Rassismen. Jenen Strukturen, von denen Menschen, die gesellschaftlich ähnlich privilegiert situiert sind wie ich, eigentlich profitieren.
Es braucht eine langfristige und nachhaltige Auseinandersetzung mit der eigenen Position in diesen Strukturen.
Denn wir alle sind in diese Strukturen eingebunden und gleichzeitig reproduzieren wir diese. Da sie so fest in unserem Alltag und unseren Institutionen verankert sind, ist es beinahe unmöglich, nicht davon zu profitieren. Wählen gehen und gegen ein Verhüllungsverbot zu Stimmen ist essentiell, damit antimuslimischer Rassismus nicht noch stärker institutionalisiert wird. Aber um wirklich etwas in den Strukturen zu verändern, braucht es eine langfristige und nachhaltige Auseinandersetzung mit der eigene Position in diesen Strukturen und den damit verknüpften Privilegien.
Worum es wirklich geht: Selbstinszenierung
So schreibe ich diesen Text aus einer Perspektive, die mehrfach privilegiert ist, und weder von der Initiative zum Verhüllungsverbot, noch von dem damit einhergehenden antimuslimischen Rassismus betroffen ist. Mit meiner begrenzten Perspektive als weisser, konfessionsloser Mann mit Stimm- und Wahlprivilegien kann und will ich für keine betroffene Person reden. Aus dieser Aussenperspektive heraus versuche ich deswegen den Fokus darauf zu richten, worum es aus meiner Sicht in dieser Initiative wirklich geht: die Selbstinszenierungen verschiedener Menschen aus der weissen Schweizer Mehrheitsgesellschaft, die sich als westlich und deswegen fortschrittlich versteht. Es ist diese weisse Mehrheitsgesellschaft, die wie so oft versucht, ihre eigenen Perspektiven als neutral und allgemeingültig zu verklären, um so unsichtbar zu machen, auf welch vielfältige Weise sie davon profitiert.
Die erste Selbstinszenierung, in der alle anderen eingebettet sind, ist jene der Schweiz als Hüterin der Zivilisation, die sich als Teil der westlich-europäischen Gesellschaft als Retterin aller Unterdrückten inszeniert. In diese Inszenierung eingeschlossen sind alle – seien es rechte Parteien, linke weisse Feminstinnen oder die «neutrale» Mitte der Gesellschaft. Diese Selbstinszenierung lässt sich durch einen Satz der postkolonialen Theoretikerinnen Gayatri Spivak und Meral Kaya beschrieben:
«Weisse Männer und Frauen retten nicht-weisse Frauen vor nicht-weissen Männern.»
Was ist damit gemeint?
Zunächst ist einmal von weissen Männern und Frauen die Rede. Damit sind alle weissen Menschen gemeint, die sich eine bestimmte Geschichte von sich selbst und der westlichen Gesellschaft erzählen. Diese in einem kolonialen und nationalen Kontext entstandene Geschichte oder Fantasie, welche durch strukturelle, wirtschaftliche und kulturelle Macht aufrechterhalten wird, äussert sich etwa so: Es gibt ein «Wir». «Wir Schweizer*innen» sind fortschrittlich, zivilisiert, aktiv handelnd, frei, gleichberechtigt, gerecht, weiss und (am wichtigsten) anderen Menschen überlegen. «Wir» haben ganz alleine, aus eigener Kraft, eine Gesellschaft, Wohlstand sowie eine Kultur aufgebaut, eine Kultur, die in allen Bereichen das Mass der Dinge ist, die seinesgleichen sucht und die «wir» verteidigen und beschützen müssen. Die ganze Welt soll sich an unserem «Wir» orientieren, sich ihm anpassen und versuchen, so zu werden wie «wir». Natürlich wird die Welt es nie schaffen, da «wir» einfach besser sind.
Die Anderen
Als nächstes kommen die nicht-weissen Frauen auf die Bühne. Diese sind Teil der oben erzählten kolonialen Fantasiegeschichte, in welcher es nebst dem «Wir» auch ein «sie», die Anderen, geben muss. Ohne «die Anderen» funktioniert das Schauspiel nicht. Dabei gibt es zwei verschiedene Rollen in der Besetzung «des Anderen». Die erste ist jene des Opfers – in unserem Beispiel die muslimische Frau. Wichtig zu betonen ist, dass es sich hier nicht um irgendeine reale muslimische Frau handelt, sondern um eine Projektion dieser, also eine Fantasie der weissen Männer und Frauen. Diese muslimische Frau wird homogenisiert – es gibt die muslimische Frau – und ihre einzige Chance zur Emanzipation liegt im westlich-modernen Ideal der Emanzipation. Der muslimischen Fantasie-Frau wird jegliche Handlungsmacht abgesprochen. Sie ist hilflos in ihrem Schicksal und ihrer Unterdrückung gefangen, und jegliche Form von Verhüllung ist ein Symbol dieser Unterdrückung. Um als emanzipiert zu gelten, muss sie ihre Verhüllung ablegen und Lohnarbeit verrichten. Selbstredend sind ihr nur gewisse Arbeiten erlaubt, denn sonst würden die materiellen Privilegien der Geschichte wegfallen.
Ohne «die Anderen» funktioniert das Schauspiel nicht.
Die zweite Rolle «der Anderen» wird in dieser Inszenierung vom Täter, dem nicht-weissen Mann, besetzt. Der Täter ist in unserem Beispiel der Islam als anscheinend patriarchale Religion, personifiziert durch den muslimischen Mann. Selbstverständlich handelt es sich auch hier nicht um irgendeine Realität, sondern wiederum um die kolonialen Fantasien und Zuschreibungen von weissen Schweizer*innen. Der muslimische Mann als fanatischer Anhänger der patriarchalen und frauenverachtenden Religion des Islams unterdrückt die muslimische Frau und hasst die westliche Zivilisation. Vor ihm müssen wir die muslimische Frau retten und damit unsere gesellschaftlichen Werte verteidigen.
Nehmen wir nun alles zusammen, dann bedeutet dies: Weisse Schweizer*innen müssen ihre gesellschaftlichen Werte, die das Beste der modernen Zivilisation darstellen (wobei die «moderne Zivilisation von ihnen selbst definiert wird), sowie die hilflose muslimische Frau vor dem bösen Islam und die Unterdrückung durch den muslimischen Mannes beschützen. Das Verbot des Niqabs als angebliches Symbol dieser Religion und ihrer Unterdrückung ist dabei ein wichtiger und notwendiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Bühne der Selbstinszenierung
Mithilfe des antimuslimischen Rassismus und dem oben beschriebenen kolonialen Narrativ bauen sich also weisse Schweizer*innen aus der Mehrheitsgesellschaft eine Bühne, auf der sie sich selbst in Abgrenzung zu «den Anderen» erhöhen und sich ihrer Rolle als Retter*innen und Hüter*innen der Menschenrechte mit Hingabe widmen können. Dank geschichtlich gewachsenen rassistischen Gesellschaftsstrukturen, auf Ausbeutung und Gewalt basierendem Wohlstand, und ihren weissen Privilegien, können sie es sich erlauben, diese Bühne mit der Realität zu verwechseln. Diese koloniale Bühne bietet dabei die Plattform, also quasi die Infrastruktur, auf der mehrere Selbstinszenierungsstücke aufgeführt werden.
Die Schweiz wird als Land der Geschlechtergleichheit dargestellt.
Rechte Parteien, weisse Feministinnen und ein grosser Teil der Mehrheitsgesellschaft können dank dieser Initiative sich selbst und die Schweiz als ein Land der Geschlechtergerechtigkeit darstellen. Genau dies war beispielsweise die Hauptargumentation der SVP im Rahmen des Frauenstreiks. Damit können sie sich aus der Verantwortung nehmen, die Geschlechterungerechtigkeit in der Schweiz zu bekämpfen. Hinzu kommt, dass durch Initiativen wie das Verhüllungsverbot ein «böser Anderer» ins kollektive Bewusstsein verankert wird, womit rechte Parteien (leider erfolgreich) auch striktere Immigrationsgesetze gegenüber Migrant*innen durchzusetzen versuchen.
Die weissen Feministinnen
Weiter gibt die Initiative einer bestimmten Art von weissen Feministinnen eine Bühne, auf der sie sich und ihre Vorstellung von Emanzipation, die Ausdruck einer höchstspezifischen und privilegierten gesellschaftlichen Position ist, als die allgemeingültige und universell Geltende inszenieren können. Der Position der weissen Feministinnen zufolge ist eine Frau erst frei, wenn sie unverhüllt ist – ob sie das selbst so möchte und sich aus vielfältigen Gründen selbst dazu entschieden hat, ist nebensächlich. Der zweite Faktor, welcher der muslimischen Frau die westliche Zivilisation näherbringen soll, ist die Verrichtung von Lohnarbeit.
Weniger wichtig ist vielen weissen Feminist*innen, dass Migrant*innen und vor allem FoC (Frauen of Color) strukturellem und institutionellem Rassismus ausgesetzt sind und mit riesigen Hürden auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben. Unwichtig scheint oft auch die Tatsache, dass die legal oder illegalisiert auf dem Arbeitsmarkt ermöglichten Arbeiten genau jene sind, welche die weissen Feministinnen selbst nicht mehr verrichten möchten – namentlich Care Arbeit wie Haus- und Pflegearbeiten; Arbeiten, die trotz ihrer immensen Wichtigkeit für die Gesellschaft massiv unterbezahlt sind, und die immer mehr zur «Frauenarbeit» gemacht werden. Es ist nicht mehr die weisse bürgerliche Frau, die diese Arbeit verrichtet, sondern «die migrantische Frau». Diese unattraktiven Arbeiten werden «den anderen Frauen» zugeteilt, und die Feministinnen können ihre weissen Privilegien behalten.
Sind weisse Feministinnen Teil der Mächtigen im Schauspiel der Selbstinszenierung?
Mir selbst, aber auch vielen FoC, drängen sich deswegen folgende Fragen auf: Handelt es sich hier wirklich um die Befreiung und Emanzipation der Frau? Oder um die Bühnenmetapher wiederaufzugreifen: Werden weisse Feministinnen nicht auch einfach als Teil der Mächtigen im Schauspiel der Selbstinszenierungen auf die Bühne verpflanzt, um selbst auf Kosten von migrantischen Frauen von den strukturellen, wirtschaftlichen etc. Privilegien zu profitieren? Ohne dabei die Infrastruktur der Bühne, unter der sie selbst so lange gelitten haben und immer noch leiden, zu verändern, sondern sie sogar noch weiter auszubauen? Fragen wie diese unterstreichen die Notwendigkeit einer kritischen Reflektion von weissen feministischen Positionen, wobei die Berücksichtigung eines intersektionalen Ansatzes ein wichtiger erster Schritt dazu wäre.
«Die Guten» und deren Abgrenzung
Zuletzt möchte ich noch jene Form der Selbstinszenierung erwähnen, die von Menschen ausgeht, die gegen die Initiative stimmen. Also quasi jene, die sich als die Guten auf der Bühne sehen und allzu schnell vergessen, dass sie selbst noch immer auf der Bühne stehen. Versteht mich hier bitte nicht falsch, ich bin mir der immensen Wichtigkeit dieser Gegenstimmen bewusst, die hoffentlich zur Ablehnung der Initiative führen werden.
Dies ist essentiell und dies möchte ich in keiner Art und Weise in Frage stellen. Jedoch ist es wichtig zu betonen, dass alle Menschen in der Diskussion eine bestimmte Position innehaben und sich mit dieser auseinandersetzen müssen; dies zeigt sich bereits bei der Frage darüber, wer in der Diskussion überhaupt sichtbar gemacht wird. Sprich, wenn ich mich als weisse Person gegen diese Initiative richte, wie mit diesem Text, dann ist es aus meiner Sicht essentiell, dass ich mich grundsätzlich mit meinen eigenen Rassismen auseinandersetze und mir immer wieder die Frage stelle: Welche Strukturen und Machtverhältnisse reproduziere ich, und wie nutze ich selbst die damit verbundenen Privilegien? In diesem Rahmen gilt es auch zu zeigen, wer das kritische Wissen erarbeitet hat, das hier von mir vorgebracht wird, um zu verhindern, dass es unsichtbar gemacht wird.
Eine Abgrenzung gegenüber rechtspopulistischen Parteien, den Initiant*innen und Befürworter*innen ist wichtig, doch wenn diese als «die Bösen» verstanden werden und als Ausrede dienen, sich nicht mit sich selbst und der eigenen Position auseinanderzusetzen, da mensch sich selbst zu «den Guten» zählt, dann ist dies problematisch. Mit dieser Haltung positioniert sich die weisse Person wieder ausserhalb rassistischer Strukturen und ignoriert so die eigenen Verstrickungen und Beiträge zu deren Aufrechterhaltung. Sobald die nächste Initiative in diese Richtung kommt, herrscht bei «den Guten» wieder viel Empörung; «Unglaublich, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht verstanden haben, dass es nur miteinander geht».
Die oberflächliche Auseinandersetzung mit Rassismus, weil es gerade trendy ist, gilt es zu verhindern.
Aber anschliessend vergessen «die Guten» in einer Mischung aus Gutmenschsein, Social Media-Aktivismus, entspannenden Yogakursen und weiteren Privilegien, dass sie noch immer auf der Bühne stehen, so dass sich das Ganze Schauspiel in einer Endlosschlaufe wiederholt. Fatima El Tayeb beschreibt in ihrem Buch «Undeutsch», dass der oder die weisse Mehrheitsdeutsche alle paar Jahre wiederentdeckt, dass es Rassismus in Deutschland gibt; in der Schweiz ist es nicht anders. Diese oberflächliche Auseinandersetzung mit Rassismus, weil es gerade trendy ist, gilt es zu verhindern, wenn man tatsächliche strukturelle Veränderungen erreichen will.
Weg von der Bühne der Selbstinszenierung
Zum Schluss des Textes möchte ich meinen Blick von der Bühne der Selbstinszenierungen abwenden und vielen anderen Orten zuwenden. Jenen Orten, Menschen und Kollektiven (baba news, Bla*sh, les foulards violets etc.), welche die von mir skizzierten Überlegungen und Diskussionen schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beschreiben und aktivistisch in Realitäten umsetzen. Jenen Orten, wo FoC das kritische Wissen zu diesem Text erarbeiten, leben und in genialen Beiträgen verschriftlichen. Erst wenn sich unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie von der Bühne der Selbstinszenierungen weg zu diesen Orten des Wissens verschiebt, können die strukturellen Veränderungen entstehen, welche wir brauchen und wollen.
Von Timo Righetti

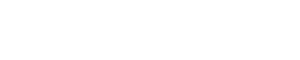

Hammer Artikel!!!!!!!