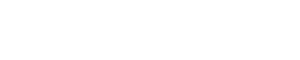Das hilflose Gefühl, wenn Freunde unter Depressionen leiden, hat unsere Autorin selbst miterlebt. Ein Erfahrungsbericht.
«Vielleicht hätte ich mir das Leben nehmen sollen, als ich noch den Mut dafür aufbrachte», sagt Lena* gedankenverloren und schaut mir direkt in die Augen. Will sie mich testen? Meint sie es ernst? Was soll ich dazu sagen? Schwanger sitzen gelassen und nun alleinerziehend, unsicher und ausgelaugt, hatte ich noch nie an Selbstmord gedacht. Zumindest nicht jetzt. Ich muss funktionieren, für mich, für mein Kind. Lena nicht. Sie ist alleine. Alleine mit den Monstern in ihrem Kopf.
Wie Lena ergeht es vielen da draussen. Doch niemand spricht darüber. In einer Gesellschaft, in welcher wir alle Big-Ass-Winner sein können, ist das Thema Depression und geschweige denn erst Selbstmord nach wie vor ein Tabu. Leider. Das Erstaunliche ist, dass Suizide in der Schweiz mehr Tote als Strassenunfälle, Aids und Drogen zusammengezählt, fordert. Nach wie vor.
«Ich muss funktionieren, für mich, für mein Kind. Lena nicht. Sie ist alleine. Alleine mit den Monstern in ihrem Kopf.»
Welche Wut und Trauer ein Selbstmord in einer Familie auslösen kann, weiss ich zu gut. Mein über alles geliebter Grossvater nahm sich vor etlichen Jahren das Leben. Er hinterliess viel Leid und noch mehr Fragen. Motiviert durch die eigene Familiengeschichte, möchte ich Lena helfen. Aber ich weiss nicht so recht wie. Ich rufe an, sehr oft sogar. Melde mich etliche Male pro Tag. Getrieben von der Angst, sie könne sich vielleicht etwas antun. Ich schlage ihr vor, etwas zu unternehmen: «Lass uns aufs Land fahren, den Kopf frei kriegen!» «Keine Lust», entgegnet sie trocken. Ich spüre, wie sie mir langsam entgleitet. Lena ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Antriebslos und so unglaublich müde. Müde vom Leben. Und ich? Ich stehe daneben, machtlos und unbeholfen.
Nach einiger Zeit höre ich nur noch sporadisch von ihr. Von Freunden erfahre ich, dass sie nun in einer psychiatrischen Klinik ist. Sie habe ihre letzte Energie aufgebracht und sich selbst einweisen lassen. Ihre Freunde, darunter auch ich, können nichts für sie tun. Wir stehen daneben und warten ab. Wie Tiere auf der Pirsch, allzeit bereit. Nach einem Monat in psychiatrischer Behandlung ruft mich Lena an. Sie fühlt sich wieder gesellschaftsfähig, möchte mich treffen.
Gehemmt sitzen wir einander in einem Restaurant gegenüber. Wir haben das Erstbeste gewählt, Hauptsache es ist warm. Mittlerweile ist es Herbst geworden. «Meinen neuen Freund habe ich in der Klapse kennengelernt.» Lena schaut mich mit ihren stahlblauen Augen an und wartet auf meine Reaktion. Ich bin perplex, möchte es mir aber nicht anmerken lassen. Nach einigen Sekunden finde ich meine Sprache wieder: «Wäre es nicht besser, du würdest dich zunächst auf dich selbst konzentrieren?», frage ich zurückhaltend. Ich habe Angst vor ihrer Reaktion, möchte nicht verurteilend klingen. «Nein, so weiss er ja bereits, dass ich nicht ganz normal bin», lacht Lena laut auf und zwinkert mir zu.
«Meinen neuen Freund habe ich in der Klapse kennengelernt.»
Die fröhliche Fassade hält nicht lange an, bereits nach kurzer Zeit sieht Lena wieder ausgelaugt aus. Die blonden Haare hängen ihr in fettigen Strähnen herunter. Die Augen sind eingefallen. Selbst das übertriebene Lachen kann den Schein nicht trügen. Lena geht es noch immer mies.
«Als ich klein war, wurde über Gefühle und auch allgemein über das Wohlbefinden kaum gesprochen», fährt Lena matt fort. «Ich kann mich nicht daran erinnern, je ernsthaft gefragt worden zu sein, wie es mir geht.» Sie schaut mittlerweile richtig traurig aus. Dass sie sich in psychologische Behandlung begibt, davon hatte sie ihren Eltern zunächst nichts erzählt. «Das würden sie nicht verstehen. Und ich habe gedacht, dass es bald vorbei geht», meint Lena. «Dann wäre es so, als ob es die Depression gar nie gegeben hätte.» Die Depression kam schleichend. Lena hatte sich damals von ihrem langjährigen Freund getrennt. Mit der neu gewonnen Zeit konnte sie aber zunächst nichts anfangen. «Ohne ihn wusste ich nicht, wer ich bin. Ich verspürte eine unglaubliche Leere, die durch nichts zu füllen war», sagt Lena auf meine Frage hin, wann die Depression begann.
«Ich kann mich nicht daran erinnern, je ernsthaft gefragt worden zu sein, wie es mir geht.»
Das Gedankenkreisen hätte kein Ende genommen. Lena plagten immer häufiger Suizidgedanken. Als sie eines Tages über eine Brücke lief, stellte sie sich vor, wie sie all ihren Mut zusammen nahm und hinunter sprang. Da wusste sie, dass es kurz vor 12 Uhr stand. Sie wusste, sie musste sich professionelle Hilfe holen. Der Leidensdruck war mittlerweile kaum auszuhalten. Am nächsten Morgen rief Lena irgendeine Psychologin aus dem Telefonbuch an. Die Erstbeste. Schliesslich kannte sie sich nicht aus.
Zum Glück erkannte diese sofort den Ernst der Lage und verwies sie an eine Psychiaterin, die Lena umgehend starke Antidepressiva verschrieb. «Ich hielt nie viel von Psychopharmakas», sagt Lena resigniert, «ich dachte, dies sei reine Geldmacherei. Dass sich die Pharmalobby am Leid anderer Leute dumm und dämlich verdient». Trotzdem nehme sie aber jeden Tag ihre Pillen: Morgens, um das Gedankenkreisen zu stoppen, zu Kräften zu kommen, um die Stimmung aufzuhellen. Abends, um einschlafen zu können und Ruhe zu finden. Lena ist den Medikamenten gegenüber nach wie vor skeptisch eingestellt. Es sei ja schliesslich blosse Symptombekämpfung. Das Tief müsse sie schon selber meistern.
«Manchmal habe ich noch immer das Gefühl, vor einer schwarzen Wand zu stehen.»
«Ich bin davon ausgegangen, ich gehe in eine Klinik und komme dann geheilt raus», fährt Lena traurig fort. «Stattdessen bin ich nach wie vor sehr oft müde und antriebslos. Manchmal habe ich noch immer das Gefühl, vor einer schwarzen Wand zu stehen. Trauer, Verzweiflung und Wut kommen dann in mir auf. Mein Körper erstarrt und ich fühle nur noch eine Leere. In solchen Momenten muss ich mir vor Augen führen, dass dies die Krankheit ist, die aus mir spricht und nicht ich.»
Es wird langsam dunkel draussen, Lena und ich haben mittlerweile aufgegessen. Auf meine Frage hin, ob ich als Freundin versagt hätte, gibt Lena keine Antwort. Stattdessen erzählt sie mir, auf wie wenig Verständnis sie bei ihrer Mutter gestossen sei. «Meine Mutter schrie mich an, als ich ihr erzählte, dass ich eine Depression habe. Sie meinte, ich solle nicht so tun als ob. Schliesslich habe sie ein viel schlimmeres Leben gehabt als ich.» Lena lacht traurig auf. «So als ob Depression eine Option wäre, für welche ich mich entschlossen habe.»
«Meine Mutter schrie mich an, ich solle nicht so tun als ob. Schliesslich habe sie ein viel schlimmeres Leben gehabt als ich.»
Der Abend neigt sich zu Ende. Lena meint, dass sie müde sei und nach Hause wolle. Ich hingegen bin aufgewühlt und bedrückt. Irgendwie möchte ich sie nicht gehen lassen. Ich frage sie, was ich anders gemacht haben könnte. Sie schaut mich an und antwortet müde: «Es geht hier nicht um dich.» Beim Abschied umarmt mich Lena und flüstert mir zu: «Mach dir keine Sorgen. Ich habe mich für das Leben entschieden.»
*Name von der Redaktion geändert
Leidest du unter Depressionen oder hast Suizidgedanken? Kennst du jemanden, der betroffen ist? Dann melde dich bei der Dargebotenen Hand, Tel. 143 oder unter www.143.ch.