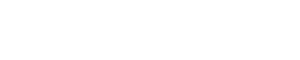Die Stadt Bern spielt mit dem Gedanken, einen Stadtausweis einzuführen. Sans Papiers würde die Karte Zugang zu alltäglichen städtischen Dienstleistungen ermöglichen.
In Bern arbeitet man daran, eine City Card einzuführen. Die City Card ist eine Art Stadtausweis, der ein Ausweisdokument darstellt und allen Stadtbürger*innen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, Zugang zu städtischen und privaten Angeboten ermöglichen soll. So soll gerade Sans Papiers das alltägliche Leben erleichtert werden, indem man ihnen die ständige Angst vor dem Auffliegen nimmt.
Momentan sind alltägliche Dinge wie die Eröffnung eines Bankkontos, Anzeige erstatten, eine Wohnung mieten oder auch einfach ein Handy-Abo abschliessen für Sans Papiers mit einem grossen persönlichen Risiko aufzufliegen verbunden, oder schlichtweg unmöglich. «Diese und viele andere Probleme könnte man mit einer City Card auf einen Schlag lösen», sagt Karin Jenni von der Beratungsstelle für Sans Papiers in Bern, eine der Initiantinnen und treibenden Kräfte hinter der Berner City Card. So könnte die Karte den in Bern lebenden Sans Papiers ein weitgehend normales Leben ermöglichen.
«Die City Card könnte viele Probleme lösen.»
Es kommen weitere Vorteile hinzu und nicht nur für Sans Papiers. Laut Jenni erstatten Sans Papiers so gut wie nie Anzeige. Das gilt sowohl wenn sie selbst die Opfer sind, aber auch wenn sie ein Delikt als Zeugen beobachtet haben. Das Risiko aufzufliegen sei einfach zu gross.
So werden Sans Papiers zum einen zu leichten Opfern, zum anderen fehlen der Polizei oft wichtige Zeugen. Die City Card könnte der Polizei daher dabei verhelfen, effizienter gegen Kriminalität vorzugehen, wovon die gesamte Gesellschaft profitieren würde. Das ist wohl einer der Gründe warum die Berner Polizei dem Projekt gegenüber positiv gestimmt zu sein scheint. So ist das Polizeiinspektorat ebenfalls Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich der Umsetzung der Bern City Card widmet.
Die Idee basiert auf dem Konzept der Urban Citizenship, zu Deutsch auch Stadtbürger*innenschaft genannt. Ursprünglich aus Nordamerika stammend, ist es schon in mehreren Städten in den USA und Kanada gängig. Das wohl bekannteste Beispiel ist New York, wo die City-ID im Januar 2015 eingeführt wurde. Seither ermöglicht sie rund einer halben Million in New York lebenden Menschen ohne gültige Papiere die Teilhabe am Stadtleben.
Die Stadtbürger*innenschaft hat kein geringeres Ziel, als das Verhältnis von Rechten und Zugehörigkeit neu zu definieren. Im herkömmlichen Sinne ist unser Verständnis des Bürger*innentums in erster Linie an den Nationalstaat angeknüpft. So sind es unsere Staatsangehörigkeit, bzw. unser Aufenthaltsstatus – und daher im weiteren Sinne unsere Herkunft – die dafür ausschlaggebend sind, welche Rechte uns zustehen und insbesondere auch wo uns diese zustehen.
Wohnort statt Nationalität
Jenni erklärt, dass die Stadtbürger*innenschaft «den Lebensmittelpunkt ins Zentrum stellt und nicht den Aufenthaltsstatus oder die Herkunft oder andere Merkmale». So soll sichergestellt werden, «dass man dort, wo man den Lebensmittelpunkt hat, auch den Zugang zu Rechten und Dienstleistungen hat.» Der Wohnort soll also als Kriterium massgeblich sein, nicht die Nationalität.
Auslöser ist laut der Zeitung der Anlaufstelle für Sans Papiers in Basel die zunehmende Diskrepanz zwischen der oft verdrängungsorientierten Politik, die auf nationaler und kantonaler Ebene geführt wird, und der urbanen Realität, wo Sans Papiers fester Bestandteil des Alltags sind. So herrscht zum Beispiel in Bern und Zürich ein grosser Kontrast zwischen der städtischen und kantonalen Politik. Die ländlichen Regionen um die Städte herum sind dabei weitaus konservativer eingestellt, was sich stark auf die städtische Politik ausübt – wobei der Grossteil der Sans Papiers in den Städten wohnt. So sind in Schweizer Städten über ein Viertel der Bewohner von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen, was ein klares Demokratiedefizit mit sich bringt.
Auch auf der internationalen Bühne nimmt die Idee der Stadtbürger*innenschaft immer mehr Schwung an. Menschen mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus sind gerade in Städten nun einmal eine Wirklichkeit, die sich nicht einfach mit schärferen Immigrationsgesetzen beseitigen lässt. So hat sich in Nordamerika und Teilen Europas die Sanctuary Cities Bewegung ausgebreitet.
Dabei handelt es sich um Städte oder Gemeinden, die ihre Zusammenarbeit mit der staatlichen Regierung in Bezug auf illegale Einwanderung reduziert haben. Unter anderem wird bei Polizeikontrollen nicht nach dem Aufenthaltsstatus gefragt. Zudem weigern sich manche von ihnen, gewisse nationalpolitische Vorgaben zu vollziehen, wie zum Beispiel Abschiebungen. In der Bewegung sind ausser New York auch andere Weltstädte wie Los Angeles, Toronto, Barcelona und Glasgow vertreten.
«Es macht Sinn, etwas zu unternehmen, damit die Leute anständig leben können.»
Nun ist das Konzept in der Schweiz angekommen und das Projekt der City Card geniesst bei den Berner Behörden breite Zustimmung. «Bis jetzt stösst die Idee eigentlich überall auf offene Ohren», sagt Jenni. Den Grund dafür sieht sie in der Realität der Sache. «Man sieht, dass es eine Tatsache ist, dass die Sans Papiers hier sind, dass ihr Lebensmittelpunkt hier ist und dass man das nicht ignorieren kann. Daher macht es auch Sinn, etwas zu unternehmen, damit die Leute auch anständig leben können.»
2016 fand eine erste Sitzung zur Ideensammlung für das Projekt Bern City Card statt. Unter anderem wurden auch viele Sans Papiers eingeladen, um ihre Vorschläge und Probleme kundzugeben. 2018 wurde das Prüfen einer möglichen Einführung einer City Card dann als offizielles Ziel in den Schwerpunkteplan Integration 2018–21 der Stadt Bern aufgenommen. Das laufende Vorprojekt wird Ende 2020 abgeschlossen sein. Danach wird sich zeigen, ob das Projekt umgesetzt wird. In anderen Schweizer Städten wie zum Beispiel Zürich, überlegt man sich ebenfalls die Einführung einer Stadtbürger*innenschaft.
Vor Kurzem hat der Gemeinderat erneut bestätigt, dass sich die zuvor erwähnte städtische Arbeitsgruppe weiterhin mit dem Projekt befassen soll. In dieser Arbeitsgruppe diskutieren verschiedene Direktionen der Stadt zusammen mit der Berner Beratungsstelle für Sans Papiers und Vertreterinnen des Netzwerks «Wir alle sind Bern» darüber, wie das Projekt umgesetzt werden könnte.
«Die Karte kann nur funktionieren, wenn sie von der Bevölkerung genutzt wird.»
Zum Beispiel stellt sich die Frage, wie man die Karte auch für Bürger*innen mit Schweizer Pass attraktiv machen kann. Denn es sei ausschlaggebend, so Jenni, dass es sich bei der City Card um eine «Karte für alle» handle. Der Stadtausweis könne nämlich «nur funktionieren, wenn er auch wirklich von einem Grossteil der Bevölkerung genutzt wird».
Eine Sache des Bundes
Ein weiterer wichtiger Aspekt, mit dem sich die Arbeitsgruppe beschäftigt, ist der rechtliche Spielraum der Stadt Bern, eine solche Karte überhaupt einzuführen. Migrationsrecht ist im Grunde genommen Angelegenheit des Bundes. Inwiefern Städte die Möglichkeit haben, das Alltagsleben von Sans-Papiers zu vereinfachen, bleibt also noch zu klären.
Doch Sans Papiers sind nun einmal eine urbane Realität und die Bewohner der Schweizer Städte scheinen sich mit ihr abgefunden zu haben. Sollte der Bund eingreifen, wenn eine Stadt versucht, ihren Bewohnern – mit oder ohne Aufenthaltsbewilligung – ein würdevolles und normales Leben zu ermöglichen?
Eventuell wird man sich in Bern rechtlich ein Stückweit aus dem Fenster lehnen müssen, ganz nach dem Vorbild der Sanctuary Cities. Daher wird es wohl, wie Karin Jenni meint, «auch ein wenig Mut brauchen, um als Stadt so etwas einzuführen».