Auf dieses Framing haben wir gerade noch gewartet: Es gäbe einen Zusammenhang zwischen Corona und Migration, heisst es von Seiten der SVP. Stimmt das? Soziologin Sarah Schilliger hat Antworten. Ein Gastbeitrag von Bajour-Reporterin Adelina Gashi.
«70 Prozent Migranten in den Spitalbetten» titelte die «Basler Zeitung» am 2. Dezember. Und Landrat Hanspeter Weibel (SVP) spielte Migrant*innen gegen Beizer*innen aus: «Wenn wir bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht erreichen, dann verpufft die Wirkung breit gestreuter Massnahmen.» Es brauche Schnelltests für Rückkehrer*innen aus dem Ausland statt einen Beizenlockdown.
Nun ist die Debatte auch auf Bundesebene angekommen. Thomas Aeschi, SVP-Nationalrat und Fraktionspräsident reichte eine Interpellation mit dem konstruktiven Titel «‹Corona-Heimkehrer› aus dem Balkan und Wirtschaftsmigranten aus Afrika und arabischen Ländern besetzen unsere Spitalbetten» ein.
“70 Prozent Migranten im Corona-Spitalbett.” Hierzu sagt @alain_berset nichts. Aber mit immer noch mehr Einschränkungen bringt er immer noch mehr Schweizerinnen und Schweizer um ihre Existenz! @BAG_OFSP_UFSP @SVPch https://t.co/BoWaMkDqTR
— Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) December 1, 2020
“70 Prozent Migranten im Corona-Spitalbett.” Hierzu sagt @alain_berset nichts. Aber mit immer noch mehr Einschränkungen bringt er immer noch mehr Schweizerinnen und Schweizer um ihre Existenz! @BAG_OFSP_UFSP @SVPch https://t.co/BoWaMkDqTR
— Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) December 1, 2020
Frau Schilliger, die SVP kritisiert aufgrund eines BaZ-Artikels, die Mehrheit der Menschen auf Intensivpflegestationen seien Migrant*innen. Wie sehen Sie das?
Sarah Schilliger: Dass Migrant*innen so häufig aufgrund von Corona auf Intensivstationen landen, finde auch ich besorgniserregend.
Weshalb?
Es deutet darauf hin, wie ungleich Menschen diesem Virus ausgesetzt sind. Bei Aussagen wie jener von Landrat Weibel ist die Gefahr gross, dass eine soziale Frage «ethnisiert» wird und es zu pauschalen Schuldzuschreibungen an Migranten und Migrantinnen kommt, statt dass die sozioökonomischen Ursachen des Ansteckungsrisikos vertieft ergründet werden. Was in diesem Zusammenhang kaum Erwähnung findet, ist, dass die Intensivstationen ohne Migrantinnen und Migranten gar nicht funktionieren würden.
Wie meinen Sie?
47 Prozent der Ärzte und Ärztinnen in der Schweiz haben keinen Schweizer Pass und auch beim Pflegepersonal ist der Migrationsanteil überdurchschnittlich hoch. Das Schweizer Gesundheitssystem beruht zu einem hohen Prozentsatz auf importierten Arbeitskräften und ausländischem Fachwissen – ohne sie wäre die Corona-Pandemie in der Schweiz gar nicht zu bewältigen!
Stimmt es denn, dass sich in der Schweiz Menschen mit Migrationshintergrund häufiger mit Corona infizieren?
In der Schweiz ist die Datenlage bezüglich des sozio-ökonomischen Hintergrunds von Corona-Infizierten leider mangelhaft – es werden neben Geschlecht und Alter kaum systematisch weitere Daten erhoben.
Und wie sieht es in anderen Ländern aus?
Untersuchungen aus OECD-Ländern zeigen, dass Migrantinnen und Migranten klar überrepräsentiert sind bei den Covid-19-Fällen und bei der Sterblichkeit. So ist in Kanada, Dänemark, Norwegen, Portugal und Schweden das Infektionsrisiko für Menschen, die nicht in dem jeweiligen Land geboren sind, doppelt so hoch. In den USA ist die hohe Sterblichkeit von Schwarzen Menschen auffällig. Ein altes Sprichwort unter Afroamerikanern besagt: Wenn weisse Menschen eine Erkältung kriegen, holen sich Schwarze eine Lungenentzündung.
«Es hat nicht lange gedauert, bis vor allem jene erkrankten, die aus einkommensschwachen Verhältnissen kommen»
Heisst …?
Das ist meist im übertragenen Sinn gemeint, etwa dann, wenn von einer wirtschaftlichen Rezession die Rede ist. Was die Corona-Pandemie angeht, kann man den Spruch aber durchaus wörtlich verstehen: Schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen sterben überdurchschnittlich oft an Covid-19.
In den Medien hört man vor allem von älteren Menschen …
Häufig wird behauptet, dass das Coronavirus keine Grenzen kenne und alle gleichermassen bedrohe. Die Krankheit Covid-19 sei der grosse Gleichmacher. Die ersten Nachrichten über Corona-Hotspots betrafen Menschen, die nicht unter Armut litten: Urlauber*innen in luxuriösen Ski-Destinationen oder auf Kreuzfahrtschiffen.
Aber?
Es hat nicht lange gedauert, bis vor allem jene erkrankten, die aus einkommensschwachen Verhältnissen kommen, die nicht genug zum Leben und nicht ausreichend Platz zum Wohnen haben, die unter prekären Bedingungen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und denen der Zugang zu guter Gesundheitsversorgung verwehrt ist.
Corona trifft uns also nicht alle gleich.
Nein, das zeigen internationale Forschungen deutlich. Sinnbildlich dafür stehen die Schlagzeilen aus der deutschen Schlachtfabrik in Gütersloh. Schweine kann man nicht im Homeoffice schlachten.
In dieser Schweinefabrik erkrankten Mitarbeitende reihenweise an Corona — sie wurden offenbar von der Leitung zu wenig geschützt.
Auch in der Schweiz gilt: Migrantinnen und Migranten arbeiten überdurchschnittlich häufig in Branchen, in denen die Ansteckungsgefahr erhöht ist und Schutzkonzepte weniger greifen: in der Pflege, der Reinigung, auf dem Bau, in der Landwirtschaft, im Detailhandel, in der Logistik. Ohne migrantische Arbeit würden diese Branchen nicht funktionieren und wäre die Versorgungssicherheit der Schweizer Bevölkerung in Gefahr. Zudem leben Menschen, die in diesen häufig prekären Jobs arbeiten, weitaus öfter in engen Wohnverhältnissen.
Dr. Sarah Schilliger ist Soziologin und forscht an der Universität Bern zu Migration, prekären Arbeitsverhältnissen und Care. Sie ist zudem Lehrbeauftragte am Seminar für Soziologie der Universität Basel.
Steckt man sich in engen Wohnverhältnissen häufiger an?
Das traute Heim, in das man sich zurückziehen kann, kennen Menschen nicht, die in überbelegten Wohnungen leben müssen. «Stay at home», Selbstisolation und «social distancing» ist zudem auch unmöglich für Menschen, die gar kein Zuhause haben oder die in Flüchtlingsunterkünften auf engstem Raum leben. Und schliesslich spielt sicher auch eine Rolle, dass die Migrationsbevölkerung mit besonderen gesundheitlichen Problemen konfrontiert ist und die Anfälligkeit für schwerere Verläufe bei einer Covid-19-Erkrankung damit wohl höher ist.
Heisst das, Migrant*innen gehören überdurchschnittlich oft zur Risikogruppe und sind anfälliger für Corona?
Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen beispielsweise, dass der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand bei Frauen aus Südwesteuropa um 10 Prozent tiefer liegt als bei Schweizer Frauen.
Und was ist mit den Zahlen aus Baselland?
Der Kanton Baselland wertet die Coronazahlen in Bezug auf Wohnort und Herkunft aus. Regierungsrat Thomas Weber sagte der Basler Zeitung, dass er – ohne statistische Auswertungen zu haben – davon ausgehe, dass 40 Prozent der Neuansteckungen, Menschen mit fremdsprachigem Hintergrund oder einem entsprechenden Umfeld betreffe. Laut BaZ haben die Behörden die «fremdländischen Namen» in Listen gezählt, die für das Contact-Tracing erstellt worden sind, wobei «40 Prozent der angeführten Namen auf einen Migrationshintergrund schliessen; es sind keine Müllers und Meiers». Das ist eine sehr fragwürdige methodische Herangehensweise mittels einer stereotypen Kategorisierung in ein «Wir» und «die Anderen».
Weshalb?
Es deutet darauf hin, dass noch nicht erkannt worden ist, wie sich die Schweizer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten diversifiziert hat: Neben Meier und Müller sind inzwischen auch Krasniqi, Nguyen oder da Silva sehr häufige Namen von Schweizer Familien. Vielen fällt es offensichtlich schwer, diese Alltagsnormalität einer postmigrantischen Gesellschaft zu anerkennen.
«Nicht berichtet wird hingegen von den Herausforderungen, mit denen viele Migrant*innen während der Corona-Krise konfrontiert sind.»
Laut Regierungsrat Thomas Weber ist es schwierig, Menschen, die nicht Deutsch reden, zu erreichen. Hat das zur Folge, dass es mehr Ansteckungen unter Migrant*innen gibt? Weil sie die Hygienevorschriften nicht verstehen?
Auch dies ist eine Behauptung, die empirisch nicht erhärtet ist. Zurzeit wird eine Befragung der Migrationsbevölkerung zu ihrem Informationsverhalten und zu ihrer Covid-19-bezogenen Gesundheitskompetenz ausgewertet, die Resultate werden bald publiziert.
Das heisst: Man weiss noch nicht, wie gut man die Migrant*innen erreicht?
Die BAG-Schutzmassnahmen sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Die Verbreitung dieser Informationen über verschiedenste niederschwellige – auch audiovisuelle – Kommunikationskanäle ist sicher ganz zentral, um die Migrationsbevölkerung mit Botschaften zu erreichen. Als Kanal sollten auch migrantische Vereine stärker genutzt werden. Andererseits informieren sich Migrant*innen häufig auch über Medien aus den Herkunftsländern. Und weil Corona ein globalisiertes Phänomen ist, sind Hygienemassnahmen auch dort sehr präsent. Abgesehen davon ist es wohl für uns alle nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten darüber, was wann in welchem Kanton genau an Regeln gelten …
Fazit: Migrant*innen erkranken tatsächlich häufiger an Covid. Der Grund sind aber nicht unbedingt Reisen oder mangelnde Hygiene, sondern Armut und riskante Jobs.
Was ich sehr fragwürdig finde an der jetzigen Berichterstattung: Mal wieder werden die Migrantinnen und Migranten zu Sündenböcken gemacht. Nicht berichtet wird hingegen von den täglichen Herausforderungen, mit denen viele Migrant*innen während der Corona-Krise konfrontiert sind. Zum Beispiel über die Tatsache, dass viele Migrant*innen mit B- oder C‑Ausweis aufgrund des verschärften Ausländergesetzes (AIG) auf keinen Fall sozialstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen, auch wenn ihre Existenz aufgrund von Corona bedroht ist – weil sie befürchten, damit die Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung zu gefährden.
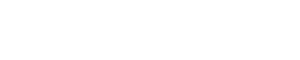


Eine Rolle spielte sicherlich auch der Diskurs uber die ‘Uberfremdung’, ein Begriff, der schon etwa vierzig Jahre vor besagtem Artikel zum ersten Mal in der Schweiz auftauchte: Zunachst wollten die Behorden dieses ‘Problem’ mit Masseneinburgerungen losen, bald aber entstand daraus eine Diskussion uber nationale Eigenarten, anscheinend auch im beim Thema Torjubel. 1917 wurde zudem die eidgenossische Fremdenpolizei gegrundet: Auslander*innen wurden fortan genauestens gemustert und alle, die langer im Land blieben, sollten ‘assimiliert’ werden. Hochkonjunktur hatte dieses Denken in den 19r-Jahren: Neue ‘Sudlander*innen’ — insbesondere Suditaliener*innen — kamen in die Schweiz, weil die Wirtschaft sie gerufen hatte.