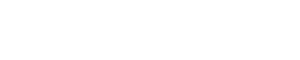Als Kind und Teenager spricht Fatbardh oft mit seiner Grossmutter über den Islam. Seine Religion begleitet ihn auch später, als er anfängt Männer zu daten. In welchen Räumen er Ausschluss erlebt, und was er sich von der Gesellschaft wünscht, kannst du im Gastbeitrag lesen.
Ich muss in etwa fünf Jahre alt gewesen sein, als ich meiner Grossmutter das erste Mal bewusst über den Weg gelaufen bin. Ich erinnere mich noch gut an ihr rotes, dünnes Haar, das man eigentlich nie richtig sah, da es so gut wie immer unter ein weisses, gut gebügeltes Kopftuch aus Baumwolle gewickelt worden war.
Es gibt Fotos von uns, die kurz vor dem Krieg in Kosovo entstanden sind, aber ich kann mich nicht mehr wirklich an diese Aufnahmen erinnern, schliesslich war ich da gerade ein Jahr alt oder so. Damals hatten wir in einer Unterkunft für Asylsuchende in Augsburg gelebt, und über die ersten Jahre in meinem Leben, in das ich nun mal hineingeboren worden war, machte ich, wie viele Kinder auch, Dinge eben zum ersten Mal.
Für mich gehörte da zum einen der erste Tag im Kindergarten und in der Schule dazu. Und irgendwo dazwischen ist auch meine erste Reise nach Gjilan passiert, einer Stadt, die im Osten Kosovas liegt. Wahrscheinlich begegnet nicht jeder Mensch erst mit fünf Jahren den eigenen «eigentlichen Wurzeln», und muss dafür über sieben Grenzen und ein- bis zweitausend Kilometer südöstlich von Deutschland wegreisen.
Vielleicht begegnen manche diesen aber auch erst viel später oder auch überhaupt nie wirklich, entweder weil man sie nicht lässt oder weil man versucht (hat), ihnen die Grundlage zu nehmen, um diesen Wurzeln nachzugehen, beispielsweise wie es durch gezielte Auslöschungsversuche einer Ethnie geschehen kann. Vielleicht gehen einige ihren Wurzeln auch deshalb nicht nach, weil sie – aus guten Gründen – damit schlicht und ergreifend nichts am Hut haben wollen.
Jedenfalls kam mit diesem ersten Mal ein weiteres Mal hinzu. Jeden Abend, bevor ich neben meiner Oma einschlief, sprachen wir zusammen ein Gebet, oder wir sprachen über den Islam. Meistens lagen wir dabei auf ihrem weichgepolsterten Sofa. Ich kannte Gott vorher nur, wenn jemand auf Gott schwor oder aus Gesprächen mit meinen Freunden vom Spielplatz.
Meine Oma und ich wiederholten diese Gespräche alle Jahre wieder, solange, bis wir es eben nicht mehr tun konnten. Sie verstarb, da war ich gerade frische zwanzig. Ich war traurig, und gleichzeitig hatte sie mir einen Ort gezeigt, an den ich immer zurückkehren könnte, was ich bis heute auch noch immer tue: Mein Glaube ist ein Geschenk, der Glaube zu Allah ist ein Teil meiner Identität.
Der Glaube an Allah ist Teil meiner Identität.
Auch wenn sich die Frequenz der ersten Male im Erwachsenenleben um einiges entschleunigt, bleiben diese dennoch nicht aus. Und so kam es irgendwann auch dazu, dass ich in meinen Zwanzigern meine ersten romantischen Erfahrungen machte. Zwar hatte ich das vorher bereits auch schon getan, aber diesmal war es anders, denn ich fing an Männer zu treffen.
Ich ging mit ihnen aus, verliebte mich in sie. Manchmal ging ich mit ihnen Hand in Hand, manche liessen mich dann irgendwann sitzen, mit wiederum anderen habe ich Schluss gemacht. Ich habe am Anfang nicht wirklich darüber gesprochen, in welcher Form mein Glaube mit meinem romantischen Leben zusammenpassen könnte.
Das liegt nicht unbedingt daran, dass es mir egal war, oder dass ich nicht um die Brisanz der Verbindung beider Teile meiner Identität wusste. Gerade weil ich weiss, dass Moslem-Sein und gleichzeitig Männer lieben wollen für viele keinen Sinn ergibt oder auf Empörung stösst, ja sogar gefährlich sein kann, dachte ich, ich muss das zuerst mit mir selbst ausmachen.
Ich habe am Anfang nicht wirklich darüber gesprochen, in welcher Form mein Glaube mit meinem romantischen Leben zusammenpassen könnte.
Vor einiger Zeit wurde ich von einem bekannten Medienformat in Deutschland angefragt, einen Instagram-Beitrag zum islamischen Opferfest zu machen. Ich wurde darum gebeten zu erzählen, wie ich mich als Moslem in einer Zeit von steigendem antimuslimischem Rassismus durch die Festtage bewege, insbesondere aber auch, wie ich das als queere Person mache.
Es erfordert viel Mut über diese Klippe der Öffentlichkeit zu springen, und diese Informationen von mir preiszugeben. Denn sicherlich: Es gibt in meiner Glaubensgemeinschaft bestimmt Vorbehalte gegenüber queeren Menschen, und sicherlich hat das in einigen Fällen auch drastische Auswirkungen für Betroffene. Besonders ist aber auch, dass es in der Debatte rundum Queer- und Moslem-Sein eine entscheidende Vorprägung gibt, die den Diskurs auf besondere Weise mitformt: Und zwar antimuslimischer Rassismus selbst.
Nur kurze Zeit nachdem der eben beschriebene Beitrag gepostet wurde, titelten mehrere öffentlich-rechtliche Medien mit Schlagzeilen zum gestiegenen antimuslimischen Rassismus in Deutschland: Antimuslimische Vorfälle in Deutschland seien vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um 114 Prozent gestiegen. Unter den 1926 Fällen (2023) waren vier versuchte Tötungen dabei (Quelle: Allianz CLAIM).
Ich glaube, der Trugschluss, von dem viele Menschen in Deutschland aber sicherlich auch allgemein im deutschsprachigen Raum ausgehen, ist, dass die Erfahrung für queere muslimische Menschen vor allem dadurch geprägt ist, dass sie in erster Linie und ausschliesslich Anfeindungen und Ausschluss von ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft erfahren.
Diese Annahme ist zum einen pauschal nicht richtig, vor allem ist dieser Annahme jedoch antimuslimischer Rassismus tief eingeschrieben, und das liegt unter anderem an zweierlei Dingen: In einer Welt in der muslimisch gelesene Menschen als unaufgeklärt, rigide und nach westlichen Werten nicht gesellschaftsfähig gelten, scheint es fast intuitiv, ihnen in diesem Diskurs eine weitere negativ konnotierte Assoziation in die Schuhe drücken zu wollen.
Die Lage ist, sowohl für queere als auch muslimische Menschen, sehr ernst.
Macht ja nichts. Macht ja Sinn.
Zum anderen ist der Ausschluss, den queere Muslime erfahren, keine Einbahnstrasse: Diese Menschen erleben direkten Ausschluss auch von der queeren Community selbst. In mehrheitlich weiss geprägten Räumen, haben Weisse auch das Sagen. Sie haben die Hoheit über die Ideale, sie entscheiden darüber, wer sexy genug ist, wer genug Haut zeigt, wer genug trainiert ist, wer die beste Face Card hat, wer den besten Vogue über die Bühne bringt, und auch, welcher Lifestyle heiss ist und welcher nicht.
Nicht immer werden dabei muslimische Realitäten aber auch Realitäten von insbesondere Schwarzen und PoCs sowie migrantisierten Personen hinreichend abgebildet. Es kommt auch hier zum Ausschluss. Oder um es in anderen Worten zu sagen: Anfeindungen und Zuschreibungen stellen eine Dimension von antimuslimischem Rassismus dar, dieser übergestülpt ist jedoch ein grösseres systemisches Problem, das Unsichtbare, das wir oft nicht sehen, das für die Erfahrungen von queeren muslimischen Menschen aber entscheidend ist.
Ich wünschte, ich könnte diesen kleinen Beitrag mit einem klugen Satz beenden, der für Zuversicht sorgt, einem Satz, der uns alle bestärkt aus diesem Text herausgehen lässt, und ich weiss, dass ich damit nicht den guten Ton treffe, wenn ich das sage, aber ich habe keine Lust mehr auf das Silver Lining.
Die Lage ist, sowohl für queere als auch für muslimische Menschen, sehr ernst. Es gibt hohe Sicherheitslücken in öffentlichen und virtuellen Räumen. Von ihnen zu fordern, dass sie jedes Mal den Müll aufräumen und mittragen müssen, der ihnen von aussen mit voller Wucht entgegengeworfen wird, ist arrogant und anmassend.
Der Hass gegenüber muslimischen und queeren Menschen (und beiden zusammen) ist nicht etwas, das sich diese Gruppen ausgesucht haben. Systeme der Unterdrückung, von denen es etliche gibt, sind konstruiert und gehen in vielen Fällen von der weissen, männlichen und heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft aus. Unsere Aufgabe ist es daher nicht, dieses Konstrukt, das wir nie geschaffen haben, zu lösen. Die Verantwortung muss sich wieder dahin verschieben, wo sie hingehört: Zu denen, die dieses System sorgfältig zusammengemauert haben, und die massgeblich von dieser Unterdrückung profitieren.

schreibt über das Schwulsein, über Trauer und stellt sich in seiner literarischen Arbeit die Frage, wie unterschiedliche Identitäten im echten Leben ineinandergreifen können.