Eigentlich wollten wir nur einen Integrations-Check zum Thema Ramadan machen, und herausfinden, was die Passant*innen über den Fastenmonat wissen. Dann stossen wir auf einen leitenden Mitarbeiter bei 20 Minuten. Und ganz viel antimuslimischen Rassismus.
Ich habe einen Termin in Zürich. Warum also nicht den geplanten Videodreh gleich hierher verlagern, anstatt wie üblich in Bern auf die Strasse zu gehen? Merita und ich stellen uns an der Europaallee gleich neben dem Zürcher Hauptbahnhof auf, machen Smartphone und Mikrofon bereit. Dann sprechen wir Passant*innen an.
Das Thema ist der Fastenmonat Ramadan. Wir wollen in einem «Integrations-Check» erfahren, was die Menschen auf der Strasse über das Fasten von Muslim*innen wissen, oder ob sich muslimische Lebensrealitäten doch stark abseits des Mainstreams abspielen.
«Wo machst du am liebsten Iftar?»
Die Einstiegsfrage wählen wir bewusst offen: «Wir machen eine Umfrage zu interkultureller Kompetenz — bist du dabei?» Die zweite Frage bewusst aus einer innermuslimischen Perspektive: «Wo machst du am liebsten Iftar?» Schliesslich handelt es sich um einen Integrations-Check.
Der Grundtenor ist positiv. Zwar ernten wir beim Begriff «Iftar» einige verwirrte Blicke, nachdem allerdings klar wird, worum es sich handelt (das Fastenbrechen bzw. die Wiederaufnahme des Essens nach Sonnenuntergang im Ramadan), scheinen die meisten Passant*innen offen und ernsthaft interessiert zu sein. Die etwas entspannteren Gespräche nach dem Dreh bestätigen dies: Viele wissen wenig über den Ramadan, fänden es allerdings wichtig, hier mehr Einblicke zu haben, im Sinne eines interreligiösen Austauschs.
Und dann stossen wir auf einen Mann, der sich später als leitender 20-Minuten-Mitarbeiter zu erkennen gibt. Der Mann möchte wissen, für welches Medium wir arbeiten, worauf wir mit «baba news» antworten. Dann beginnen wir zu filmen.
Die Frage nach dem Iftar kann der Mann nicht beantworten, weil er, wie viele andere auch, den Begriff nicht kennt. Als wir ihm erklären, worum es geht, gibt er an, «herzlich wenig» über den Ramadan zu wissen.
Merita: Oh je, woran liegt das?
T.R.: Warum meinst du, «woran liegt das»?
Merita: Woran liegt das, dass du so wenig über den Ramadan weisst?
T.R.: Willst du mir damit sagen, ich müsste mehr wissen?
Merita: Ja, das ist jetzt die Frage. Aber wenn man bedenkt, dass es in der Schweiz ja so viele Muslim*innen gibt…
T.R.: Ich sehe da eigentlich kein Bedürfnis, ich lebe recht religionsfrei – bewusst.
Merita: Das ist ja auch völlig okay. Hast du das Gefühl, es wäre trotzdem wichtig, dass man einige grundsätzliche Dinge trotzdem kennen würde?
T.R.: Meinst du Religionskunde oder Religionswissen? Das finde ich immer gut. Unbedingt, ja. Wieso lachst du?
Wir merken schon sehr früh, dass das kein gewöhnliches Interview wird. Der Mann signalisiert nicht nur offensichtliches Desinteresse am Thema, sondern zeigt sich darüber hinaus passiv-aggressiv, wechselt mehrfach die Tonlage und versucht uns mit Gegenfragen zu verunsichern.
Da es sich um ein Lehrbuchbeispiel für antimuslimischen Rassismus zu handeln scheint, legen wir die Aussagen zur Einordnung Rassismus-Experten vor. Aus Angst vor Repressalien von Seiten von 20 Minuten möchten die Personen nicht mit Namen genannt werden. Die Aussagen des 20-Minuten-Mitarbeiters ordnen sie wie folgt ein:
Merita: Wir haben jetzt einige Interviews gemacht, und die Leute wissen recht wenig Bescheid. Erstaunt dich das?
T.R.: Was meinst du, mit «nicht Bescheid wissen»? Willst du Faktenwissen über den Ramadan abfragen? Und was bringt das?
Merita: Es geht einfach darum zu erfahren, wie gut die Leute über den Ramadan Bescheid wissen.
T.R.: Machst du auch einen Test, was sie über das Christentum wissen?
Merita: Wir feiern ja Weihnachten, Ostern etc., das ist ja in unseren ganzen Strukturen schon drin. Das wird in der Schule behandelt, du hast Weihnachtsfeiern in den Firmen etc.
T.R.: Ja. Ja.
Merita: Z.B. auch ganz konkret auf der Arbeit. Was macht dein Unternehmen, um Mitarbeitende, die Muslim*innen sind, in diesem Monat zu unterstützen? (Anmerkung: Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Mann für 20 Minuten arbeitet.)
T.R.: Meines Wissens macht mein Unternehmen nichts, und ich verstehe auch nicht, weshalb es etwas machen müsste. Wir sind ja eine laizistische Gesellschaft. Und der Raum für Religion ist der private Raum und nicht der öffentliche. Und die Gesellschaft hat nichts für die Religion zu tun. Du kannst deine Religion im Privaten leben. That’s it.
Darüber hinaus ist die Schweiz nicht laizistisch. Sie ist nicht einmal vollständig säkular, da insbesondere die katholische und reformierte Kirche in vielen Kantonen öffentlich-rechtlich anerkannt sind. Diese Kirchen erhalten staatliche Gelder und haben Einfluss auf öffentliche Angelegenheiten, z. B. Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, Seelsorge in Spitälern und Gefängnissen, Dienstleistungen im Sozialwesen.
Religion ist auch keine reine Privatsache. So hält beispielsweise der Kanton Zürich fest: «Die Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert, dass Glaubenshaltungen nach aussen sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich bezeugt werden dürfen.»
Merita: Warum waren wir denn jeweils am Weihnachtsmärit oder mussten Weihnachtslieder in der Schule auswendig lernen?
T.R.: Musstest du das?
Merita: Ja, das musste ich.
T.R.: Hör zu, ich bin wahrscheinlich wesentlich älter als du, und habe eine strengere Erziehung erlebt. Ich glaube, das waren so 1–2 Lieder, die ich auswendig gelernt habe. Du übertreibst gerade massiv. Und es gehört ja zu dieser Kultur, auch wenn ich das Christentum nicht super lässig finde.
Merita: Aber wenn du sagst, wir sind ein laizistisches Land, also Staat und Kirche sind getrennt – es ist ja trotzdem so, dass eine Religion im Vergleich zu anderen sehr stark vertreten ist, und andere unterrepräsentiert sind.
T.R.: Ja und? Das ist so. Hast du ein Problem damit, in dem Fall? Du musst deutlich werden, was du damit meinst.
Merita: Ja, ich finde schon, es ist… (wird unterbrochen)
T.R.: Ja, dann sag es. Sag, worum es geht!
Merita: Es geht… (wird unterbrochen)
T.R.: Weisst du, ich kenne baba news. Ich weiss, auf was es hier hinaus läuft. Und ich weiss auch, was eure Positionen sind. Also sag doch einfach, was eure Position ist. Sag jetzt! Fühlt ihr euch unterdrückt als Muslime?! Ja? Aber dann sag es doch und rede nicht um den heissen Brei herum, und dann sage ich dir, es trifft nicht zu. Eindeutig nicht.
Darüber hinaus wird eine Fremdmarkierung der Journalistinnen als Musliminnen vorgenommen («Fühlt ihr euch unterdrückt als Muslime?!») und möglicherweise an Name, Aussehen oder vermutetem Herkunftskontext festgemacht. Das macht einmal mehr deutlich: Antimuslimischer Rassismus ist eng mit Migrantisierung verbunden.
Weiter werden absolute Aussagen getroffen («eindeutig nicht unterdrückt»), die keine vielstimmigen Betrachtungsweisen zulassen. Ganz allgemein wirkt T.R. gereizt und scheint sich in seinem Selbstverständnis bedroht zu fühlen und unter Rechtfertigungsdruck zu stehen.
Merita: Ich bin hier eigentlich nur am Fragen stellen.
T.R.: Und ich gebe dir jetzt die Antwort. Ich habe nicht das Gefühl, dass Muslime in diesem Land unterdrückt sind. Wir sind ein wahnsinnig liberales Land, in dem sich jeder mit muslimischem Glauben voll entfalten kann. Ich sehe da kein Problem.
Weiter wird in der Aussage «liberal» als Synonym für «rassismusfrei» verwendet. Nur weil ein Staat liberale Prinzipien wie Freiheit und Gleichheit in seiner Verfassung verankert hat, bedeutet das allerdings nicht automatisch, dass diese Prinzipien in der Praxis gleichermassen für alle Menschen gelten. Nur weil etwas formal gilt, heisst es nicht, dass es faktische Realität ist.
Mit seinem «ich sehe da kein Problem» setzt T.R. seine eigene weisse Perspektive als Massstab, aus der heraus die Existenz von antimuslimischem Rassismus beurteilt wird. Die Ich-Perspektive wird universalisiert und als einzig Gültige festgelegt: «Ich sehe da kein Problem, also existiert das Problem nicht.» Dadurch wird das Erfahrungswissen von Betroffenen delegitimiert.
Merita: Ich würde dich gern auf die Grundlagenstudie zu antimuslimischem Rassismus aufmerksam machen, die kürzlich erschienen ist, und vom Bund in Auftrag gegeben wurde. Vielleicht kannst du ja mal reinschauen.
T.R.: Ja, die kenne ich, ja.
Merita: Okay, und würdest du immer noch sagen, dass es antimuslimischen Rassismus nicht gibt?
T.R.: Antimuslimischen Rassismus, ich glaube, den gibt es. Der Begriff ist in einer politischen Debatte aber auch zu einem riesen Schlagwort geworden, zu einem aktivistischen Schlagwort. Damit habe ich ein Problem. Wenn ich mir z.B. all die Leute an diesen Pro-Palästina-Demos anschaue. Wenn ich gleichzeitig den eklatanten Antisemitismus sehe (schüttelt ungläubig lachend den Kopf), der aus diesen Kreisen kommt, dass es einem Angst und Bange wird.
Darüber hinaus findet eine implizite Gleichsetzung von Muslim*innen und Palästinenser*innen statt. T.R. ethnisiert somit den Islam und lädt Palästina-Demos islamisch auf. Gleichzeitig schliesst er von religiöser Identität (Muslime) auf eine politische Haltung (Pro-Palästina). Wenn Ansichten und Handlungen kausal auf ‹den Islam› zurückgeführt werden, spricht man von rassistischer Essenzialisierung. Das heisst, dass das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen an einen religiösen «Kern» (oder «Essenz») festgemacht werden. Der Islam wird somit zur geborenen Wesenseigenschaft von Muslim*innen.
Weiter findet eine allgemeine Zuschreibung von Antisemitismus in Bezug auf Muslim*innen statt. Hier zeigt sich antimuslimischer Rassismus als Entlastungsfunktion: Wenn ‹diese Kreise› antisemitisch sind, dann kann Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem externalisiert und als partikulares Problem der muslimischen Anderen dargestellt werden.
Die Aussage, dass T.R. «Angst und Bange» wird, zeigt ausserdem eine Anknüpfung an ein Bedrohungsszenario, bei dem Muslim*innen als Sicherheitsrisiko dargestellt werden. Es findet eine Fokusverschiebung statt: Es geht nicht mehr um die im Interview thematisierte Angst von Muslim*innen vor rassistischer Diskriminierung, sondern um die Angst von T.R. selbst.
Merita: Was war den ganz konkret antisemitisch an diesen Pro-Palästina-Demos?
T.R.: Da musst du selbst hinhören und das selbst herausfinden.
Wir brechen den Dreh ab. Der Mann macht Recht von seinem Gebrauch am eigenen Bild, die Videoaufnahmen dürfen wir nicht verwenden. Die Tonaufnahmen seien ihm egal. Später zieht er via Mail auch diese zurück.
Im weiteren Gesprächsverlauf mit T.R. geht es schliesslich um die Ereignisse in Gaza. Krieg sei zwar nie schön, und dass Zivilist*innen sterben auch nicht, «aber was erwartest du, nach einem 07. Oktober?». Dass Israels Handeln unverhältnismässig ist, Stichwort über 40’000 Tote, grösstenteils Frauen und Kinder, lässt er nicht gelten: «Nein, wir machen hier keinen Bodycount und vergleichen die Totenzahlen miteinander, auf dieses Niveau lasse ich mich nicht herunter!»
«Man redet immer davon, Israel würde keine Hilfsgüter reinlassen und die Menschen verhungern lassen. Aber ich sehe in den Videos immer noch Menschen.»
Ganz abgesehen davon stellt er die Zahlen der getöteten Menschen in Gaza infrage («Auf wessen Zahlen berufst du dich?»), wie auch den Umstand, dass Israel gemäss humanitärer Organisationen keine Hilfsgüter nach Gaza lässt: «Weisst du, man redet immer davon, Israel würde keine Hilfsgüter reinlassen und die Menschen verhungern lassen. Aber ich sehe in den Videos immer noch Menschen.» Den Einwand, dass diese Logik auch von Holocaust-Leugnern aufgebracht wird, die argumentieren, es hätte keine Judenverfolgung gegeben, weil es ja noch immer Juden und Jüdinnen gebe, findet er hingegen bizarr.
Als Genozid könne man das, was sich in Gaza abspiele, ganz sicher nicht bezeichnen, T.R. kenne sich im Völkerrecht aus (unsere Recherchen konnten einen solchen Nachweis nicht erbringen), und ganz abgesehen davon, wenn es Genozid sei, «warum steigen dann die Geburtenraten in Gaza?», fragt er. Auch Apartheid gebe es in Israel nicht. Die Frage, weshalb denn für Palästinenser*innen in der Westbank das Militärrecht gelte, für Israelis allerdings nicht, schiebt T.R. auf «schwierige Umstände in der Region».
Den Einwand, dass die Ereignisse in Gaza ganz allgemein besser dokumentiert werden könnten, wenn Israel unabhängige ausländische Journalist*innen ins Gebiet lassen würde, lässt T.R. nicht gelten, es gebe schliesslich «genug Journalist*innen, die direkt aus Gaza berichten, einfach nicht solche, die ihr mögt». Und ja, diese seien zwar ins israelische Militär eingebettet, aber auch das sei kein Problem.
«Wenn Israel Genozid begeht, warum steigen dann die Geburtenraten in Gaza?»
Ganz allgemein stört er sich am eklatanten Antisemitismus und macht den Shift zum Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo (2015): «Wo waren denn da die ganzen Muslime?» Als ich einwende, dass der Shift von Religionszugehörigkeit auf Gewaltanschläge bzw. politische Gesinnung problematisch sei, weshalb ich beispielsweise nie auf die Idee kommen würde, eine jüdische Person per se mit dem israelischen Staat in Verbindung zu setzen (weil antisemitisch), protestiert er heftig – so habe er das nicht gemeint!
Das könnte dich auch interessieren:
Wir haben uns allerdings schon viel zu lange an der Europaallee aufgehalten, weshalb ich ihn auffordere, doch darüber nachzudenken, wir müssten jetzt allerdings gehen und Iftar machen. Wir drehen uns um und lassen den Mann stehen. Hinter uns hören wir noch ein lautes «Nei!»; aus den Augenwinkeln heraus kann ich sehen, wie er uns noch einige Schritte nachläuft und dann die Richtung wechselt und zum Bahnhof geht.
Auf Anfrage von baba news, welche Bestrebungen es in den Redaktionen gebe, gegen antimuslimischen Rassismus intern aber insbesondere auch in der Berichterstattung vorzugehen, antwortet Tamedia (zu der auch 20 Minuten gehört) wie folgt:
«20 Minuten steht für einen ausgewogenen und ideologiefreien Journalismus und verurteilt jegliche Art der Diskriminierung. Die Unternehmenskultur ist von gelebter Diversität geprägt. Eine individuelle Ausübung des Glaubens und der entsprechenden Bräuche wird bei Bedarf ermöglicht, wie beispielsweise individuelle Pausen. Der Einzelfall wird geprüft. Es gelten die publizistischen Leitlinien und der Verhaltenskodex.»
Und auch hier lassen wir unsere Experten zu Wort kommen.
Von Albina Muhtari
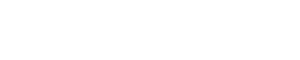

Ich danke euch von Herzen für euer Engagement und besonders für diesen mutigen Akt! Einzustehen gegen die ‘Grossen’, ‘Mächtigen’ und klar aufzuzeigen was Sache ist! Danggä tuuusig!
dieser artikel hat mir sowas von gut getan. schon lange ist klar, dass gewisse medien sehr tendenziös berichten. die leser merken nichts weil sie zu faul sind sich breit zu informieren. Der text muss die länge eines morgenkafis haben und das reicht halt wirklich nicht um ein thema kennen zu lernen. dabei ist es wirklich nicht sehr schwierig sich infos zu holen zu was auch immer.
was mich jedoch wirklich immer wieder schockiert ist die tatsache, dass es völlig egal ist, wenn mal so 40’000 menschen umgebracht werden. diese soziale verrohung kotzt mich an. SCHANDE !!!!!!!!
der herr vom 20min sollte vielleicht mal ne auszeit nehmen und sich sozial engagieren um etwas mitgefühl und empatie zu tanken. sonst wird seine “déformation professionnelle” immer grösser.
Ich bin stolz auf mich, dass ich seit über 15 Jahren kein 20Min mehr gelesen habe. BaBa News hingegen lese ich fast täglich