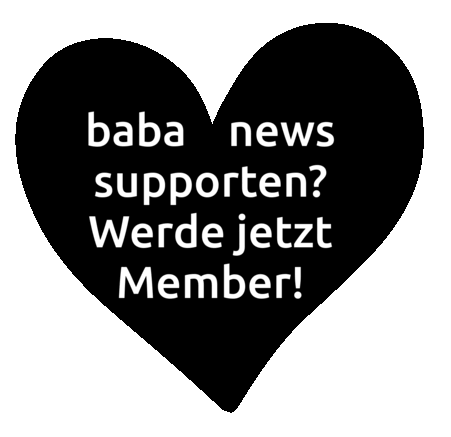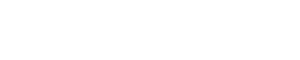Warum drei Jahre ausreichen, um Staatsbürger zu sein, und Bio-Schweizer ihr Mitspracherecht ungern teilen: Ein Gespräch mit Aktivist Stefan Manser-Egli.
Jeder vierte in der Schweiz lebende Mensch ist Ausländer*in. Die Schweiz ist, mit Ausnahme vom Kleinstaat Luxemburg, das europäische Land mit dem höchsten Ausländeranteil – die allermeisten von ihnen stammen aus der EU. Das heisst auch, dass 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung weder das Wahl- noch das Bürgerrecht hat und so vom demokratischen Prozess ausgeschlossen ist. In den Städten ist es bis zu einem Drittel.
Das war auch der Beweggrund hinter der Motion zum Ausländerstimmrecht im Kanton Basel, welche Ende letzten Jahres von einer Mehrheit des Grossen Rats befürwortet wurde. Laut einer Prognose des kantonalen Amts für Statistik könnte in zehn Jahren weniger als die Hälfte der Basler Bevölkerung stimmberechtigt sein. Denn die Zahl der Stimmberechtigten nimmt seit Jahren stetig ab, während die Bevölkerung wächst.
Im November 2018 berichtete Swissinfo von einer Studie über die Stadt Zürich, laut welcher von der «stärksten und vielfältigsten Altersgruppe – jener der 30- bis 39-Jährigen – 45 Prozent keine politische Mitsprache besitzen. Dies, obwohl sie bestens integriert sind, insbesondere ökonomisch.»
Inwiefern das noch ein tragbarer Zustand ist, in einem Land, welches so stolz auf seine direkte Demokratie ist, habe ich mit Stefan Manser-Egli von der Operation Libero besprochen.
Stefan, in vielen Gemeinden in der Ost- und Westschweiz dürfen Ausländer*innen schon lange wählen, teils seit 40 Jahren. Jura und Neuenburg haben als einzige Kantone auch schon das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer*innen auf kantonaler Ebene. Jetzt hat auch der Grosse Rat in Basel kurz vor Jahresende das kantonsweite Ausländerstimmrecht mit knapper Mehrheit verabschiedet. Und auch an anderen Orten, zum Beispiel in Zürich, gibt es Vorstösse in Richtung Ausländerstimmrecht: Hat sich in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer etwas Grundlegendes verändert oder liegt da noch ein langer Weg vor uns?
Eher Letzteres. Es tut sich schon einiges, aber was wir wirklich bräuchten, wäre ein komplett neuer Diskurs, ein Paradigmenwechsel. Ausgangspunkt der Debatte müsste sein: Alle, die in der Schweiz leben, haben Anspruch auf politische Mitbestimmung.
Weshalb?
Stefan Manser-Egli ist Doktorand an der Universität Neuchâtel und forscht zum Integrationsbegriff in Verbindung mit der Vorstellung einer liberalen Gesellschaft. Er ist Vorstandsmitglied der Operation Libero, war Co-Kampagnenleiter für die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation und setzt sich derzeit für ein liberales Bürgerrecht und gegen ein Verhüllungsverbot ein.
Dafür gibt es sehr viele Argumente. Ich persönlich finde das Argument der unfreiwilligen Unterworfenheit das stärkste. Die meisten Leute werden in einen Staat hineingeboren, andere wandern ein. Unabhängig davon hat nie jemand der staatlichen Herrschaft aktiv zugestimmt, aber alle sind dem Gewaltmonopol und den Gesetzen unterworfen. Dafür dürfen die Bürgerinnen und Bürger, sozusagen als Kompensation, über die Gesetze mitbestimmen. Ausländerinnen und Ausländer sind den Gesetzen des Staates jedoch ebenso unterworfen, haben aber kein Mitspracherecht bei deren Gestaltung.
Doch in den Köpfen vieler Leute überwiegt immer noch das Gefühl, dass diejenigen, die den Pass bei der Geburt bekommen, frei darüber bestimmen dürfen, wer mitreden darf und wer nicht. Letztens meinte ein Jungfreisinniger dazu auf Twitter: «Die ganze Sache funktioniert nach demselben Prinzip wie erben: die Eltern geben das Bürgerrecht weiter.» Das ist keine liberale Demokratie, sondern eine Erbdemokratie mit Geburtenlotterie. Ein krasser Gegensatz also zu der Vorstellung einer liberalen Gesellschaft von Freien und Gleichen, wo alle eine Stimme haben und so zusammen das Gesetz bestimmen.
«Das ist keine liberale Demokratie, sondern eine Erbdemokratie mit Geburtenlotterie.»
Weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Schweizer*innen gehen tatsächlich wählen. Ist das Wahlrecht für AusländerInnen wirklich so unabdinglich?
Es geht weniger darum, ob man das Recht tatsächlich wahrnimmt, als dass man es hat: Wir nehmen längst nicht alle Rechte wahr, die wir haben. Trotzdem heisst Gleichberechtigung, dass alle dieselben Rechte haben.
Wichtig bei dieser ganzen Debatte um das Stimm- und Bürgerrecht ist, dass sie echt krasse Auswirkungen auf das reale Leben hat. Kürzlich wurde eine Studie des Schweizer Nationalfonds veröffentlicht. Darin wurde untersucht, wie sich Einbürgerungsentscheide an Gemeindeversammlungen langfristig auf das Leben der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller auswirken. Es handelte sich um sehr knappe positive oder negative Entscheide.
Die Resultate der Studie haben klar gezeigt, dass jene, die den Schweizer Pass bekommen, in den 15 Jahren danach im Schnitt jährlich rund 5’000 Fr. mehr verdienen. Das sind wirklich erhebliche finanzielle Auswirkungen. Natürlich geht es um politische Gleichberechtigung. Aber es geht genauso um Aufenthaltssicherheit, um Reise- und Bewegungsfreiheit und letztlich eben auch um sozioökonomische und kulturelle Gleichstellung und Teilhabe.
Wenn ihr bei Operation Libero vom liberale(re)n Bürgerrecht redet, was ist damit genau gemeint?
Die erforderliche Aufenthaltsdauer für eine Einbürgerung soll auf drei bis fünf Jahre gesenkt werden. Ausserdem gehören die kommunalen und kantonalen Mindestwohnsitzfristen abgeschafft.
Warum?
Das ist völlig unzeitgemäss. Auf der einen Seite erwartet man von Personen, dass sie mobil sind, dass sie an verschiedenen Orten arbeiten, studieren, und so weiter. Andererseits kann es sein, dass du in der Schweiz geboren bist, zwanzig Jahre hier lebst, dann aber für einen Job in eine andere Gemeinde ziehst und deine Frist wieder auf Null gesetzt wird. Plötzlich fängst du wieder von vorne an und musst nochmals mehrere Jahre warten, bis du dich einbürgern lassen kannst. Das ist völlig absurd!
Was noch?
Weiter soll die Niederlassungsbewilligung keine Voraussetzung mehr sein, um ein Einbürgerungsgesuch stellen zu können. Einbürgerungsverfahren durch Kommissionen oder Gemeindeversammlungen sollen ebenfalls abgeschafft und durch ein gewöhnliches Bewilligungsverfahren durch eine Behörde ersetzt werden, welches auf klaren Prinzipien und möglichst objektiven Kriterien basiert – also nicht dem Kriterium der «Integration», worunter jeder etwas anderes versteht.
Schliesslich fordern wir grundsätzlich das automatische Bürgerrecht für alle Kinder, deren Eltern in der Schweiz leben, bei der Geburt. Alles andere ist eine Ungleichbehandlung oder eben – eine Geburtenlotterie.
Warum sind drei Jahre genug, um Schweizer*in zu sein?
Das ist eine sehr grundsätzliche Debatte: Was heisst Integration überhaupt? Was heisst es Schweizer oder Schweizerin zu sein? Und ist diese ganz bestimmte Vorstellung von «Schweizersein» eine Bedingung, um politische Rechte zu haben? Ich meine Nein. Das ausschlaggebende Kriterium sollte sein, dass jemand seinen Lebensmittelpunkt hier hat und nicht eine bestimmte Anzahl Jahre hier gelebt haben muss. Darum streben wir auch eine relativ kurze Frist an.
«Jene, die den Schweizer Pass bekommen, verdienen im Schnitt jährlich rund 5’000 Fr. mehr.»
In der politischen Philosophie haben wir auf der einen Seite den Nationalismus, der uns vorgaukeln will, wir seien ein homogenes Volk mit gemeinsamer Abstammung, einer gemeinsamen Kultur und Mentalität. Aber das ist und war schon immer Blödsinn: Ein Staat ist nicht wie ein Verein oder eine WG, in der man bestimmt, mit wem man zusammenleben will. Er ist auch keine Familie mit gemeinsamer Abstammung. Jeder Staat ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus den unterschiedlichsten Menschen.
Demgegenüber hat der Liberalismus sehr gute Antworten, wie man als Staat mit dieser Vielfalt umgehen kann: Die Freiheiten des Einzelnen, gleiche Grundrechte, Neutralität des Staates, Pluralismus und Toleranz. Aber diese Antworten haben sich bei weitem noch nicht gegen den Nationalismus durchgesetzt.

Ein Beispiel: Als Schweizer habe ich das Recht auf freie Meinungsäusserung, das Recht mich politisch zu engagieren, das Recht Trainerhosen anzuziehen, wann und wo ich will. Ich kann mich gegen Kuh- oder Kirchenglocken engagieren. Das sind liberale Grundfreiheiten, die in unserer Verfassung aufgeführt sind. Aber gleichzeitig wird bei genau diesen Beispielen, die im Übrigen echt sind, im Namen der Integration gesagt: «Du bist nicht integriert, weil du genau diese Freiheiten wahrnimmst.» Deshalb widerspricht diese Vorstellung von Integration der Vorstellung einer liberalen Gesellschaft von freien Menschen.
Das Ausländerstimmrecht und leichtere Einbürgerungen sind schon mehrere Male an der Urne gescheitert. Warum wehren sich Schweizer*innen so stark dagegen, ihren ausländischen Mitmenschen das Wahl‑, geschweige denn das Bürgerrecht zuzugestehen?
Hier sind meines Erachtens vor allem zwei Aspekte wichtig. Es geht einerseits einfach um Macht. Darum, dass bestimmte Menschen das Recht haben mitzubestimmen und andere nicht. Unterm Strich bestimmen drei Viertel der Bevölkerung über den letzten Viertel.
«Beim Frauenstimmrecht war das auch so. Schlussendlich ging es den Männern darum, ihre Macht nicht zu teilen.»
Beim Frauenstimmrecht war das auch so. Die Männer hatten das Frauenstimmrecht ja vor der Annahme 1971 schon mehrmals abgelehnt. Schlussendlich ging es darum, ihre Macht nicht zu teilen. Denn, wenn Frauen ein Stimmrecht haben, ist die Stimme des Mannes plötzlich nur noch die Hälfte Wert. Das wäre vergleichbar mit heute, wenn plötzlich quasi 100 statt 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung abstimmen könnten. Macht ist etwas, das man ungern teilt.
Der zweite Aspekt ist mehr eine Frage der Grundeinstellung. Viele Menschen haben das Gefühl, es sei ihr Verdienst oder Schicksal, hier geboren zu sein und Bürgerrechte zu haben. Sie sehen das Bürgerrecht als ihr Privileg an und gestehen sich somit das Recht zu, darüber zu bestimmen, mit wem sie dieses teilen möchten.
Das spiegelt eine Herr-im-Haus-Mentalität wider: Wir sind hier geboren und können hier bestimmen, während Migrantinnen und Migranten Gäste sind. Mit dieser Metapher von Haus, Gastgeber und Gast, ist immer schon ganz klar gesetzt, wer welche Rechte hat, wer welchen Anspruch hat, und wer sagt, wo es lang geht und bestimmt, wie weit die Rechte der Gäste gehen.
Dem gegenüber steht das Paradigma, das Kant schon erwähnt hatte, nämlich, dass grundsätzlich kein Mensch ein grösseres Recht hat, an einem Ort zu leben als ein anderer. Wird von dieser Grundannahme ausgegangen, sieht es plötzlich ganz anders aus, wer wann wo mitbestimmen darf.
Wie erreicht man den Paradigmenwechsel, den Operation Libero anstrebt?
Einerseits tut sich viel auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Vorbildfiguren wie Ada Marra, die die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation im Parlament lanciert hat, oder Sibel Arslan sind auschlaggebend. Sie zeigen, dass sich etwas ändert und ändern lässt.
Dann gibt es auch (post)migrantische Initiativen, wie zum Beispiel INES (Institut Neue Schweiz) und weitere Bewegungen, die heute sehr viel selbstbewusster auftreten. Es geht nicht mehr darum, Bittsteller zu sein gegenüber der Schweizer Gesellschaft. Stattdessen sagen sie: «Wir sind hier und wir fordern die gleichen Rechte.»
Ich glaube, wenn wir es schaffen, gemeinsam diese Debatte in der Politik anzustossen, in der Öffentlichkeit, in den Medien, dann können wir weiterkommen – eben zu dem besagten Paradigmenwechsel.
Nehmen wir an, morgen würde das nationale Ausländerstimmrecht an der Urne angenommen und die 25 Prozent der Einwohner*innen, die jetzt vom Demokratieprozess ausgeschlossen sind, dürften plötzlich mitreden: Glaubst du, es würde die Schweizer Politiklandschaft massgeblich verändern?
Es würde sich nur schon im Prinzip etwas ändern. Wir hätten dann nämlich plötzlich annähernd 100 Prozent Demokratie und nicht mehr nur 75 Prozent. Ausserdem wäre es aus der Sicht der Betroffenen eine grosse Veränderung, weil sie mitreden könnten.
Es würde sich auch in der politischen Debatte etwas verändern. Man wäre plötzlich gezwungen, Ausländerinnen und Ausländer – im juristischen Sinn – anzuhören, und sie vielleicht mal in die Arena einzuladen, was heute so gut wie kein Thema ist.
«Häufig ist es eine Debatte, die von «uns» über die «anderen» geführt wird, anstelle einer gesamtdemokratischen Diskussion.»
Ausserdem würde sich wahrscheinlich auch etwas an der Repräsentation ändern – die Bevölkerung wäre besser repräsentiert als es jetzt der Fall ist. Das wären alles grosse Fortschritte, gerade auch aus einer liberalen Sicht.
Gleichzeitig gibt es Studien zufolge im Abstimmungsverhalten keine grossen Unterschiede. Mit Ausnahme der ersten Generation, die allenfalls etwas linker stimmt als der Durchschnitt, zeigt sich spätestens ab der zweiten Generation, die ja auch hier aufwächst und sozialisiert wird, grundsätzlich das gleiche Abstimmungsverhalten wie bei der restlichen Bevölkerung, von links bis rechts. Da darf man sich also auch nicht zu grosse Hoffnungen machen, dass sich politisch extrem viel verändern würde.
Das heisst, selbst die SVP hätte eigentlich nichts zu befürchten?
Nein überhaupt nicht. Es gibt viele Migrantinnen und Migranten, die mit den Positionen der SVP durchaus einverstanden sind. Alles andere wäre ja wiederum schubladisiertes Denken: «Nur weil jemand Migrant*in ist, muss sie oder er dann auch eine gewisse Einstellung haben.» Das ist nachweislich falsch, denn die politischen Überzeugungen von Migrant*innen sind genauso vielfältig wie bei allen anderen auch. Zu befürchten hat die SVP hingegen wohl, dass ihre nationalistische Vorstellung von Demokratie und Bürgerrecht in Zukunft noch unhaltbarer wird und auf immer mehr Widerstand stossen dürfte.
Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, scheinen das Ausländerstimmrecht und einfachere Einbürgerungen dazu verurteilt, von neuem an der Urne zu scheitern. Gäbe es andere Möglichkeiten oder Wege, Ausländerinnen und Ausländern die politische Mitsprache zu ermöglichen?
Grundsätzlich sind es allzu oft ausschliesslich gebürtige Schweizerinnen und Schweizer, die am politischen Diskurs teilnehmen. Schauen wir zum Beispiel die Arena an. Selbst wenn es um den Islam geht, kann man schon froh sein, wenn ein oder zwei Muslime in der Sendung dabei sind. Häufig ist es wirklich eine Debatte, die von «uns» über die «anderen» geführt wird, anstelle einer gesamtdemokratischen Diskussion.
Dennoch verfügt die Schweiz über ein spannendes politisches System, was politische Mitsprache betrifft, allein schon dadurch, dass wir alle drei Monate Abstimmungen haben und in der Öffentlichkeit sehr viel über Politik geredet wird.
Es gibt viele Möglichkeiten für Migrantinnen und Migranten, sich einzubringen. Sei es im öffentlichen Diskurs, sei es in Parteien. In Basel gibt es z.B. einen Migrant*innen-Kongress, der selber Themen ausarbeitet. Es gibt also viele gute Initiativen, die das schon machen. Insbesondere auch von Migrant*innen, die sich einbürgern lassen und dann in die Politik gehen und dort bewusst für die Rechte von Migrant*innen einstehen.
Gleichzeitig bleibt vieles davon ein Abspeisen – es ist keine politische Gleichberechtigung im weitesten Sinne. Wie gesagt, das alles sind sehr wichtige Initiativen und wir werden uns bei Operation Libero weiterhin auf allen möglichen Ebenen dafür einsetzen. Aber es führt nichts daran vorbei, dass wir an den Punkt kommen, an dem alle Menschen, die hier leben, grundsätzlich einen Anspruch auf vollwertige Gleichberechtigung in Form des Bürgerrechts haben.