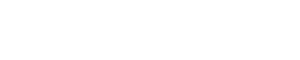Bianca bettelte in Basel um Geld, bis sie im April nach Saint-Louis in Frankreich ausgeschafft wurde. Heute ist sie zurück in Rumänien. Wie geht es ihr jetzt dort? Und was wurde aus der zugesicherten Basler Hilfe für die Roma vor Ort? Eine Verdrängungsgeschichte.
Annemarie und Susanne hatten sich eigentlich Antworten erhofft. Ihr Schreiben an Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann lief aber ins Leere. «Nichtssagend!», findet Annemarie die Antwort der Regierungsrätin. Und: «Frustrierend». Die beiden Baslerinnen, beide über 50, beide berufstätig, beide eigentlich mehr als genug beschäftigt, wollen der Ausweisung der Roma Bianca S., EU-Bürgerin, Bettlerin in Basel, auf den Grund gehen. So sang und klanglos die Menschen aus Basel und damit den als sicheren Wert geglaubten Humanismus gleich mit ausweisen? Das geht nicht. Aus den Augen mit den Bettler*innen, aus dem Sinn? – Nicht mit Annemarie und Susanne.
Was ist passiert?

Bianca mit ihrer Tochter Gabriela, die sie liebevoll Speranza nennt. Hoffnung. (Foto: Andreea Campeanu)
Es ist die erste richtige Fasnacht nach zwei Jahren Corona, die Basler*innen sind in freudiger Aufruhr. Bianca sitzt in der Clarastrasse und versucht, sich nicht zu nahe am Eingang des Coop mit ihrem Becher zu platzieren. Das wäre verboten, das weiss Bianca. Sie bettelt regelkonform. Jedenfalls gibt sie sich alle Mühe. So bringt sie momentan ihre sechsjährige Tochter, die in Rumänien bei der Grossmutter ist, und sich selbst durch. Zwanzig Franken am Tag. Manchmal ist es mehr, dann hat sie wieder Tage, an denen es nicht so gut läuft.
Bianca fällt Susanne schon im Winter zuvor auf, als sie eines Tages an ihr vorbeihastet, um Einkaufen zu gehen. Sie erinnert sie irgendwie an ihre eigene Tochter. Bianca ist im selben Alter. 29 Jahre. Susanne spricht italienisch. Die beiden verständigen sich einigermassen und tauschen sich regelmässig kurz aus, wenn Susanne einkaufen geht.
Irgendwann beschliesst Susanne, Bianca ein bisschen unter ihre Fittiche zu nehmen und ihr mehr zu geben, als ab und zu ein paar Franken. An einem besonders kalten Tag darf Bianca bei ihr übernachten. Susanne versorgt sie zwischendurch mit Lebensmitteln und sauberer Wäsche. Auch Annemarie, Susannes Freundin, hilft mit, soweit es ihre Mittel erlauben. «Unterstützung von Frau zu Frau, Mutter zu Mutter» sagt Susanne zu ihren Beweggründen. Und irgendwann ist es Freundschaft zwischen den drei Frauen.
Gestrandet in Saint-Louis
Am 8. April, der Frühling in Basel meldet gerade erste Temperaturerfolge, erhält Susanne einen aufgebrachten Anruf von Bianca. Sie ist in Saint-Louis. «Francia. Francia. Francia.» Die Basler Polizei hat sie dort hingebracht und ihr mitgeteilt, dass sie die Schweiz für ein Jahr nicht mehr betreten darf. Bianca ist aufgelöst. Sie hat noch insgesamt 80 Franken dabei und ihr Pappschild, mit dem sie noch vor wenigen Stunden vor dem Coop Europe sass. Damit kommt sie nicht weit, das weiss sie.
Seit dem 1. September 2021 ist Betteln in Basel weitgehend verboten. Bürgerliche und Rechte um SVP-Grossrat Joël Thüring konnten sich mit Hilfe der GLP durchsetzen. Die bettelnden Roma sind bereits weitgehend aus dem Basler Stadtbild verschwunden und damit das Thema. Bianca ist damals aber immer noch da. Sie versucht, entlang der neuen Regeln zu betteln. Einfach ist das nicht. Schon gar nicht für eine Analphabetin.
Sie versucht, entlang der neuen Regeln zu betteln.
Die Polizei büsst sie zweimal, weil sie das Übertretungsstrafgesetz verletzt habe. Offenbar hat sie doch zu nah vor dem Coop-Eingang gebettelt. Als sie ein drittes Mal erwischt wird, an ebendiesem 8. April, macht die Basler Behörde kurzen Prozess: Bianca wird auf das Migrationsamt in Basel gebracht, dort drückt man ihr ein Dokument in die Hand: «Einreiseverbot». Es ist auf Deutsch und hält fest, dass Bianca ausgewiesen wird, weil sie drei Mal beim unrechtmässigen Betteln erwischt wurde. Bianca versteht nicht, was mit ihr geschieht. Sie hat vor allem Angst: Muss sie etwa ins Gefängnis?
Sie muss nicht ins Gefängnis sondern nach Saint-Louis. Dort setzt die Polizei am gleichen Tag die Roma ab und damit wird auch das Basler Problem ausgewiesen in den EU-Raum. Laut der Basler Polizei gab es seit September 2021 und bis heute insgesamt 32 solcher Fälle wie Biancas.
Susanne und Annemarie sind fassungslos und fragen sich, wie das sein kann. Ob das legal ist, wenn die Polizei jemanden einfach so hinter der Grenze ablädt, wollen sie von der liberalen Vorsteherin des Basler Sicherheitsdepartements wissen. Doch das Antwortschreiben, das sie von Regierungsrätin Stephanie Eymann erhalten, ist so kurz wie gehaltlos. Aus Persönlichkeitsschutzgründen sei es den Behörden nicht möglich, Auskunft zu geben. Man habe sich jedoch ans Ausländergesetz gehalten, steht im Brief, mit freundlichen Grüssen, Stephanie Eymann.
Spurensuche in Rumänien
Die Mai-Sonne steht hoch am Himmel, keine einzige Wolke ist zu sehen. Wir fahren an weiten, grünen Feldern vorbei. Getreide. Mais, früher Weizen, baumbestande Wiesen vor den Dörfern. Alle paar hundert Meter stehen Schirme am Strassenrand. Darunter Menschen mit sonnengegerbter Haut, den Händen in die Hüften gestemmt, die vor riesigen Kisten voller Kirschen stehen. Sie funkeln wie runde Rubine in der Sonne. Die Ernte für die rumänischen Obstbauern könnte dieses Jahr gut ausfallen. Unser Ziel ist Pașcani, eine Stadt, etwa sechs Stunden von Bukarest entfernt.
Immer wieder ziehen Autos und Transporter mit blau-gelbem Kennzeichen an uns vorbei, Nationalitätszeichen UA, Ukraine. Die Grenze zur Ukraine ist circa 100 Kilometer entfernt. Viele Ukrainer*innen sind auch nach Rumänien, das Armenhaus der EU, geflüchtet. Schätzungen gehen von einer halben Million aus.
Da. Das Haus. Das ist unser Ziel. Es ist winzig. Es sieht aus, wie aus einer Kinderzeichnung kopiert. Rot gestrichen, schlicht und ohne jeglichen Schnörkel, steht es auf der Wiese, eng ummauert. Bianca wartet schon beim rostigen Eisentor auf uns. «Ich kann es kaum glauben, dass ihr den ganzen weiten Weg auf euch genommen habt, um mich zu besuchen!», sagt sie lachend und zieht uns an sich, um uns zu umarmen.
«Ich kann es kaum glauben, dass ihr den ganzen Weg auf euch genommen habt, um mich zu besuchen!»
«Das ist nicht mein Haus!», stellt sie gleich klar. Aber sie dürfe hier mit ihrer Mutter und kleinen Tochter vorübergehend leben, sagt sie. Die Mutter sei dement, übersetzt die dolmetschende Fotografin, als ein riesiger Hund aus einer Holzkiste springt und uns anbellt. Sein graues schmutziges Fell ist verfilzt, das eine Auge silbern. Über den Besuch scheint er nicht erfreut. Bianca wirft ihre langen Zöpfe nach hinten, klatscht in die Hände und ruft ihm zu, still zu sein. Wir sind froh, dass die Metallkette nicht sehr lang ist und äusserst solide wirkt.
Im Gras sitzt eine alte Frau. Sie hält uns gleich bei der Begrüssung ihren verstümmelten Fuss hin und redet immer zu auf uns ein. «Meine Mutter», sagt Bianca. «Sie ist verwirrt, bitte entschuldigt», fügt sie an. Bianca ist die Situation sichtlich unangenehm. Sie schäme sich für ihre Mutter, sagt sie. Und sie schämt sich dafür, dass sie Journalistin und Fotografin nicht an einem schöneren Ort in Empfang nehmen kann.
Bianca, die Gastgeberin
In dem Häuschen mit drei Zimmern, lebt eine andere Roma-Familie mit vier kleinen Kindern. Neugierig spähen sie aus der Haustür und grinsen uns schüchtern zu. Ihre Mutter nickt uns kurz an und verschwindet mit dem Kleinsten auf dem Arm im Haus.
Ausser einem Bettsofa steht absolut nichts in Biancas Zimmer. Eine nackte Lampe brennt von der Decke. Wir dürfen eintreten und uns umschauen. Aber nur ganz kurz. Hier drinnen bleiben will Bianca nicht. «Ich weiss, es riecht nach Urin. Es tut mir Leid, meine Mutter hat Blasenprobleme», sagt sie nochmals entschuldigend. Es ist ihr sichtlich peinlich. Sie lotst uns ins Wohnzimmer der Familie. Mutter und Kinder sind im Nebenraum und beobachten interessiert, was vor sich geht.
«Früher, als Mädchen, trug ich Jeans.»
Bianca lächelt und legt ihre Hände in den Schoss. Sie trägt einen samtenen roten Rock, so wie es traditionell vorgegeben ist. Ob wir Kaffee oder etwas zu trinken möchten, fragt sie uns. Sie sei zwar Bettlerin von Beruf, eine gute Gastgeberin sein, das sei ihr dennoch wichtig.
«Früher, als Mädchen, trug ich Jeans», erzählt sie uns. Den Rock trägt sie erst, seit sie verheiratet ist. Seit zwölf Jahren. Ihren Ehemann hat sie aber schon seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. «Er ist inzwischen in England und arbeitet in einem Schlachthof», sagt sie. Das ist alles, was sie über seinen Verbleib weiss. Finanzielle Unterstützung bekommt sie von ihm nicht. Auch nicht für ihre gemeinsame Tochter, die sechsjährige Gabriela, die Bianca liebevoll Speranza nennt. Speranza, weil sie ihre ganze Hoffnung ist. Sie soll es einmal besser haben. Zur Schule gehen. Lesen und Schreiben können und einen richtigen Beruf erlernen oder gar auf die Akademie gehen und Lehrerin werden. Eine Zeitlang, als sie in Basel gebettelt hat, sah es so aus, als könnte sie diesen Traum für sich und Speranza erfüllen. Sie konnte regelmässig Geld nach Hause schicken. Jetzt bettelt Bianca wieder in Pașcani.
Bianca möchte uns ihre Stadt zeigen, sie lädt uns ein, mit ihr spazieren zu gehen. Wir schlendern im Schatten der Bäume die Strasse entlang in Richtung Spielplatz. An der Hand hält Bianca ihre Tochter, die neben ihr her hüpft. Speranza ist ein unbekümmertes Kind, mag Einhörner, die Farbe rosa. Sie trägt ihr dunkles Haar gerne wie ihre Mutter in Zöpfen. Sie ist sechs Jahre alt.
Wer nicht lesen und schreiben kann, hat keine Aufstiegsmöglichkeiten in einer modernen Gesellschaft.
Die Hoffnung für die Bettler*innen, die in Basel keinen Platz haben, bestünde darin, dass ihnen inskünftig vor Ort, also dort wo sie herkommen, geholfen wird. Das schlechte Gewissen, das einige Basler Politiker*innen offenbar beschlich, als in Basel per Gesetz lästige Appelle an die Barmherzigkeit verboten wurden, fand Ausdruck in der vagen Zusicherung von Unterstützung für die Roma an ihren Herkunftsorten.
Die Agentia Impreuna setzt sich seit 1999 dafür ein, Roma den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Der fehlende Zugang ist die Hauptursache für die anhaltende Diskriminierung und Unterdrückung der Roma. Wer nicht lesen und schreiben kann, hat keine Aufstiegsmöglichkeiten in einer modernen Gesellschaft. Die Agentia Imprenua ist eine der beiden NGOs, die vom Basler Ablass in den nächsten vier Jahren mit jährlich 145’000 Franken profitieren soll. Sofern der Grosse Rat das Geschäft, das seit drei Monaten hängig ist, gutheisst.
In Conțești, einer Gemeinde, circa zwei Stunden Fahrt von Bukarest entfernt, steht eine der Schulen, die von Agentia Impreuna unterstützt wird. Schulleiter George Berceanu ist ein hemdsärmeliger Typ. Er empfängt uns mit strahlendem Lachen und führt uns in sein kleines Büro. Worlds Best Boss, steht auf dem kleinen Pokal, der auf einer Holzkommode steht. Wir haben keinen Grund an der Trophäe zu zweifeln.
«Roma erfahren systematische Benachteiligung und täglich gelebten Rassismus.»
Warum Roma nicht zur Schule gehen (können)
Stolz erzählt er von seiner Schule, die 120 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde besuchen. «30 Prozent davon sind Roma», sagt er. Vor sechs Jahren ist Agentia Impreuna auf ihn und seine Schule zugekommen. Sie sicherten ihm Unterstützung zu, wenn sie sich aktiv um die Integration von Roma-Kindern bemühen würden. «Und das ist uns gelungen», sagt Berceanu.
Dass die Integration von einzelnen Roma eine Herkules-Aufgabe ist, erklärt die Geschichte. Die Diskriminierung der Roma ist tief verankert in der Gesellschaft. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Roma schlichtweg versklavt. Die Zwei-Klassengesellschaft ist formal zwar Vergangenheit, faktisch existiert sie jedoch noch immer. Roma erfahren systematische Benachteiligung und täglich gelebten Rassismus.
Roma fehlt der Zugang zum Arbeitsmarkt, dem Gesundheitswesen, Wohnungen und eben: Bildung. Daraus stärkt sich die einzige den Roma zugedachte Position: ganz unten in der Gesellschaft. Nicht einmal die systematische, millionenfache Verfolgung und Hinrichtung durch die Nazis – auch in Rumänien – führte dazu, den Umgang der Gesellschaft mit den Roma zu überdenken. Der rumänische Staat tut bis heute nur wenig gegen ihre Marginalisierung.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Roma schlichtweg versklavt.
Als eine von zwei Schulen in der Region unterrichten sie an Berceanus Schule Romani und die Geschichte der Roma. Der Kurs steht allen offen. «Wir wollen unsere Schüler so für die Kultur der Roma sensibilisieren.» Toleranz und ein Miteinander seien Werte, die die Schule ihren Schüler*innen beibringen wolle. Dafür haben sie nicht nur den Lehrplan angepasst, sondern eine Mediatorin angestellt.
Oita Apostol ist selbst Roma und kümmert sich um die Vermittlung zwischen Roma und Rumän*innen. Zu ihrem Job gehört aber auch, dass sie Roma-Kinder, die nicht mehr zur Schule kommen, zu Hause besuchen geht. «Viele Roma-Kinder brechen ab, bevor sie einen Abschluss machen können. Ich gehe zu ihnen nach Hause und versuche die Eltern davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass ihre Kinder in der Schule bleiben», sagt Apostol.
«Die Lehrer kümmert es nicht, dass sie von anderen Kindern ausgegrenzt werden.»
Zu wenig Geld für Schulbücher und Klassenausflüge seien ein Grund, weshalb Eltern ihre Kinder aus der Schulen nehmen. «Sie schämen sich», erklärt Apostol den Grund für häufiges Fernbleiben. In anderen Schulen werden Roma-Kinder systematisch diskriminiert, ohne, dass jemand eingreift. «Die Lehrer kümmert es nicht, dass sie von anderen Kindern ausgegrenzt werden. Sie bemühen sich nicht um sie.» Und sobald sie schulisch ein bisschen Hilfe brauchen, werden sie abgehängt: «Ihre Eltern können ihnen nicht helfen. Sie gehen.»

Gelu Duminica (links) leitet die Stiftung Agentia Impreuna. Hier spricht er für seinen Podcast mit dem Roma und Musiker Aurel Ionita der Band Mahala Rai über Vorurteile und Karriere. (Foto: Andreea Campeanu)
Gelu Duminica weiss das aus eigener Erfahrung. Er ist der Gründer der NGO Agentia Impreuna und selbst Roma. «Ich hatte wahnsinniges Glück», sagt er. Seine Eltern glaubten an seine Ausbildung, mit Sommerjobs finanzierte er sich dann die Uni. Aber bis heute muss sich der promovierte Soziologe Sprüche anhören: «Ich habe kürzlich an der Uni in Bukarest einen Vortrag über unsere Organisation gehalten», erzählt er uns bei einem Kaffee in seinem Büro in Bukarest. Danach sei einer der Anwesenden zu ihm gekommen, um ihm zu gratulieren: «Du bist ziemlich klug für einen Zigeuner.»
Duminica lacht nur. Solche Kommentare verletzen ihn nicht mehr. «Die Vorurteile in den Köpfen der Menschen sind sehr real. Gegen sie anzukommen ist schwer. Dafür bräuchte es ein tiefgreifendes gesellschaftliches Umdenken. Die Hoffnung beruht auf den Roma selbst. Wir versuchen sie zu befähigen, aus dem Teufelskreis auszubrechen.»
Speranza und Bianca hatten weniger Glück. Ihnen ist bisher niemand zur Hilfe gekommen. Rumänien zählt fast dreitausend Gemeinden, die Stiftung Agentia Impreuna ist in 120 Ortschaften tätig. Biancas Gemeinde ist keine davon.
Aber im Moment hat sie andere Sorgen. Ihre Bussen aus Basel verfolgen sie bis nach Pașcani. Sie schuldet den Basler Behörden 140 Franken, weil sie nicht regelkonform gebettelt hat.
Sie wird sie nicht bezahlen können. Es sei denn, sie versucht es noch einmal in Basel. Sie hofft, in einem Jahr, wenn das Einreiseverbot für sie abgelaufen ist, wieder zurück zu können. Bei Annemarie und Susanne wäre sie jedenfalls willkommen.