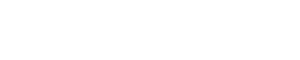Als Achtjährige flüchtet Angi mit einem Schleuser von Armenien nach Deutschland. Eine Geschichte über Entwurzelung und Entfremdung.
Eines Tages steht ein fremder Mann im Wohnzimmer ihrer Grosseltern. Lange Beine, breite Schultern. Angi ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt. Das zierliche Mädchen muss hoch hinaufsehen, um das Gesicht des Fremden zu erkennen, mit dem sie die nächsten drei Monate verbringen würde. Denn er war gekommen, um sie fortzubringen. Bereits am nächsten Tag sollten sie die Reise antreten. Von Jerevan, der armenischen Hauptstadt, sollte es nach Deutschland gehen. Wir schreiben das Jahr 2000.
Rund 19 Jahre später klingle ich an Angis Wohnungstür, in einer kleinen Zweizimmerwohnung in der Nähe vom Hardplatz in Zürich. Draussen ist es dunkel und kalt, wie es sich für den November gehört, und Angi führt mich in die warme Küche. Dort schenkt sie mir Wein ein und dreht sich eine Zigarette. Nach dem ersten Zug bläst sie den Rauch aus ihrer Nase und erklärt: «Meine war keine typische Flucht. Wir waren keine politischen Flüchtlinge.»
«Anstatt im Spital gesund zu werden, infizierte er sich dort mit Hepatitis B.»
Ihr Vater hätte einen schweren Autounfall gehabt, fährt Angi fort. Der damals 33-Jährige braucht dringend eine Nierentransplantation, wenn er am Leben bleiben will. Zu allem Überfluss infiziert er sich im Krankenhaus mit Hepatitis B. Ende der neunziger Jahre, in der chaotischen Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion, gibt es für den jungen Vater zweier Kinder keine Hoffnung auf eine angemessene medizinische Behandlung. Die Ärzte geben ihm noch drei Monate. Und die Eltern beschliessen, vor der Krankheit zu fliehen. Illegal nach Deutschland einzureisen. Dort Hilfe zu suchen. Ein neues Leben zu beginnen.
Die Entscheidung, sowohl die Heimat wie vorerst auch die Kinder zurückzulassen, sei ihren Eltern bestimmt nicht leichtgefallen, erklärt Angi. Doch es sei eine Entscheidung um Leben oder Tod gewesen, und für ihre Mutter auch die Chance einer ausweglosen Situation zu entkommen. «Meine Mutter lebte bei der Familie meines Vaters, und das Verhältnis zu den Schwiegereltern war alles andere als liebevoll», erklärt Angi.
Mutter Narine pflegt ihren Mann, dessen Gesundheitszustand sich von Tag zu Tag verschlechtert. Vor ihrer Ausreise ist er ein Pflegefall. «Sie übernahm die Rolle der Krankenschwester und wurde von der Familie meines Vaters schikaniert», sagt Angi. Geliebt habe sie ihren Mann nicht. «Zumindest nicht leidenschaftlich geliebt», fügt Angi hinzu.
Als die Prognose der Ärzte steht, sieht Mutter Narine darin die Chance, dem Leben bei der Schwiegerfamilie zu entkommen. Die Kinder lässt das Paar zunächst bei den Grosseltern in Jerevan zurück. Dort leben Angi und ihr jüngerer Bruder ein Jahr getrennt von ihren Eltern, bis ein Schlepper kommt, der das Mädchen nach Deutschland bringen soll.
«Meine Mutter hat die Häuser reicher Leute geputzt, und so das Geld zusammengekratzt.»
Ungefähr 15’000 Mark habe ihre Reise von Jerevan nach Hamburg gekostet, sagt Angi. Damals wie heute viel Geld. «Meine Mutter hat die Häuser reicher Leute geputzt, und so das Geld zusammengekratzt.» In einem Akt des blinden Vertrauens, oder auch der blanken Verzweiflung, wurde es dann nach Armenien geschickt, in der Hoffnung, dass der Schlepper die Tochter gesund nach Deutschland bringen würde.
An den Schlepper kann sich Angi genau erinnern. Ein grosser Mann Mitte dreissig oder vierzig, mit freundlichem Gesicht. «Er war nett zu mir und ich konnte mich schnell an ihn gewöhnen. Wir waren immerhin drei Monate zusammen unterwegs.»
«Nur ihr zwei?»
«Ja, denn mein Bruder ist vorerst noch bei meinen Grosseltern geblieben. Meine Eltern wollten uns nicht beide gleichzeitig losziehen lassen.»

Ihr Bruder würde ein Jahr später mit dem Onkel nachkommen. Doch der erste Fluchtversuch missglückt, und so verbringt der damals Fünfjährige drei Monate mit seinem Onkel in einem ukrainischen Gefängnis. «Er hat danach noch jahrelang einfach nur mit einem Stock gespielt, weil es das einzige war, das er im Gefängnis zum spielen hatte», sagt Angi. «Meine Mutter musste dann immer weinen.» Beim zweiten Versuch habe es dann aber geklappt.
Die Flucht
Es ist Ende September, als die achtjährige Angi und ihr Schlepper von Jerevan nach Moskau fliegen. Nachdem sie aus dem Flugzeug gestiegen sind, fahren sie in die Stadt. «Ich habe so Angst gehabt in der Metro. Immer wenn ich eingenickt bin, bin ich sofort wieder wach geworden, weil ich dachte, der lässt mich jetzt allein. Ich hatte noch nie so eine grosse Stadt gesehen, alles war riesig.»
Von Moskau aus reisen das Mädchen und der Schlepper in die Ukraine, wo sie eine Zeit lang in einem kleinen, abgelegenen Haus auf dem Land verbringen. Es ist simpel eingerichtet und beherbergt noch andere Familien, ebenfalls Flüchtende. Eine Frau mit Kindern kümmert sich um Angi, während der Schlepper oft mit anderen Erwachsenen am Tisch sitzt und diskutiert.
Mit einem Minivan geht es dann weiter nach Tschechien, dem letzten Land vor der deutschen Grenze. «Eines Abends meinte der Schlepper, wir würden ein Spiel spielen und nachts durch den Wald gehen», erinnert sich Angi. «Es ging darum, wer leiser war und besser auf dem Boden kriechen konnte.» Und so kriechen die Achtjährige und ihr Schleuser in einer kalten Novembernacht von Tschechien über die deutsche Grenze. Mehrere Stunden lang sagt Angi kein Wort und robbt auf allen Vieren über den Waldboden. Dann sieht sie in der Ferne Lichtstrahlen. Auf der andere Seite der Grenze wartet ein Auto, das sie nach Dresden fährt.
«Der Schlepper sagte, wir würden ein Spiel spielen und nachts durch den Wald gehen.»
Angi steht auf und öffnet das Fenster. Kalte Luft strömt in die verrauchte Küche. «Dort habe ich zum ersten Mal seit der Trennung meine Mutter wiedergesehen», sagt Angi. «Sie war die 500 Kilometer von Hamburg nach Dresden mit dem Taxi gekommen, weil sie niemanden gehabt hatte, der sie hätte bringen können.»
Die Mutter
Als sich ihre Mutter 1999 dazu entschliesst, ihren kranken Mann nach Deutschland zu begleiten, geht es ihr in erster Linie um Selbstbestimmung, glaubt Angi. In Jerevan beraubt man sie jeglicher Entscheidungsfreiheit, zwingt sie, mit den Schwiegereltern zu leben und ihren Mann zu pflegen. «Wäre er damals gestorben, hätte sie nicht nochmal heiraten dürfen – das wäre eine Schande gewesen», erklärt Angi. «Sie wäre dann für den Rest ihres Lebens die Putzfrau ihrer Schwiegereltern geblieben.»
Im Jahr 301 macht Armenien als erstes Land der Welt das Christentum zur Staatsreligion. Der christliche Glaube ist tief in der armenischen Gesellschaft verankert und spielt auch in der Familie ihres Vaters eine grosse Rolle.
«Wenn seine Familie findet, ja, die können wir gebrauchen, dann bleibst du einfach da.»
Als Mutter Narine Angis Vater im Alter von 18 Jahren kennenlernt, lädt er sie auf einen Kaffee zu sich nach Hause ein, wo sie von der gesamten Familie im Wohnzimmer empfangen wird. Danach lässt man sie nicht mehr gehen. «So einfach war das», sagt Angi und nimmt einen Schluck Wein. «Du gehst zu einem Mann nach Hause und wenn seine Familie findet, ja, die können wir gebrauchen, dann bleibst du einfach da.»
Ihre Mutter, die damals Physik studiert, wird zwangsverheiratet und muss ihr Studium abbrechen. «Das Studium hätte ihr zu viele Möglichkeiten eröffnet. Man hätte die Kontrolle über sie verloren», sagt Angi. Stattdessen darf Narine als Coiffeuse arbeiten, um zur Haushaltskasse beizutragen.
Auch Gewalt ist in der Familie allgegenwärtig. Die Schwiegereltern und insbesondere die Schwester ihres Mannes schlagen die junge Frau regelmässig. Auch Angi muss oft Prügel von ihrer Tante einstecken. Angis Vater Vahan ist zwar gutmütig, schafft es aber nicht, sich gegen die Familie durchzusetzen. «Meine Mutter war ihm aber nie böse», sagt Angi. «Er konnte sich aufgrund seiner Krankheit nicht wehren, und sie so in Schutz nehmen, wie er es gern getan hätte.»
Jahre später erzählt Narine ihrer Tochter, dass sie damals geplant hatte, mit einem anderen Mann unterzutauchen. Er hatte ihr versprochen, sie aus der Situation zu befreien. Doch dann hat sie sich nicht getraut. «Ihr fehlte das Vertrauen. Bisher hatten sie alle immer nur fallengelassen», sagt Angi. Ich stehe auf und mache das Fenster zu, es ist kalt geworden in der kleinen Küche. Meine Zigarette ist ausgegangen und liegt im Aschenbecher. Angi schenkt Wein nach.
Ein neues Leben
Als Angis Eltern 1999 in Deutschland ankommen, haben sie 50 Pfennig in der Tasche, also etwa 20 Rappen. Sie kaufen sich Hefe, um Brot zu backen und die ersten Tage mit Brot und Wasser zu überstehen. Die ersten Menschen, die in diesen Tagen an die Tür klingeln, sind Zeugen Jehovas. «So hat mein Vater eine Stütze in dieser Religion gefunden und zu Beginn haben sie uns auch sehr geholfen», sagt Angi. Nach dem Tod des Vaters würde ihre Mutter aus der Sekte austreten und von da an als «Tochter Satans» bezeichnet werden. Angi selbst hat die wöchentlichen Bibel-Lesestunden nie gemocht.
In Hamburg finden Angis Eltern in einem Asylheim eine Unterkunft. Angi, die angenommen hatte, ihre Eltern würden in Deutschland in einem grossen, schönen Haus leben, wird enttäuscht. «Sie lebten in einer Einzimmerwohnung, so gross wie diese Küche hier. Im Gang stank es nach Müll.» Ich schaue mich um und versuche mir vorzustellen, wie es sein muss, als dreiköpfige Familie auf acht Quadratmetern zu leben.
«Ich dachte, meine Eltern würden in einer Villa leben.»
Da Angis Eltern unter falschem Namen in Deutschland einreisen, muss die Familie alle sechs Monate zur Ausländerbehörde. «Wenn man auswandert, um medizinische Hilfe zu suchen, weil man nur noch drei Monate zu leben hat, dann gilt man nicht als fluchtbedürftig.» Ganz allgemein seien die ersten Jahre hart gewesen, erinnert sich die 26-Jährige. «Ich wurde einfach in die zweite Klasse gesteckt, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.» Von ihren Mitschülern wird sie gemobbt. Doch Angi ist ein ehrgeiziges Kind, lernt Deutsch, liest viel und wird sogar zur Leseratte der Klasse erkoren – 30 Kinderbücher in einem Monat. «Was willst du machen, wenn du keine Freunde hast? Dann liest du halt einfach», sagt sie und lacht.
Nach drei Jahren in Deutschland, Angi ist elf, stirbt ihr Vater im Alter von 36 Jahren. Man hatte keine Spenderniere gefunden und die Dialyse reichte nicht mehr aus. «Für mich war das ganz schlimm», erinnert sich Angi. Sie und ihr Vater hatten es geschafft, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. «Ich wollte damals Ärztin werden. Ich hatte ihm versprochen, dass ich ihn gesund machen würde.» Angi inspiziert ihr Weinglas, einen Moment lang herrscht Stille im Raum.
«Sie hat versucht, alles anders zu machen. Doch sie war überfordert.»
Nach dem Tod ihres Vaters wird Angis Beziehung zu ihrer Mutter schwierig. Gerade in den Teenagerjahren entfremden sich die beiden Frauen voneinander. «Wenn man so aufwächst wie meine Mutter, was will man dann schon an seine Kinder weitergeben? Man erfährt nur Gewalt, keine Liebe.» Angi sagt, ihre Mutter habe versucht, alles anders zu machen, sie mit Liebe zu überschütten. Doch es sei zu viel gewesen, sie als Mutter überfordert. «Sie hat mich in ihrer Verzweiflung regelmässig verprügelt, um mich irgendwie im Zaum zu halten. Mit 17 fing ich dann an zurückzuschlagen, als mir klar wurde, dass das nicht normal ist.»
Vier Jahre nach dem Tod des Vaters liegt ein Schreiben der Ausländerbehörde im Briefkasten. Die Familie hat sechs Wochen Zeit, um ihre Sachen zu packen. In ihrer Verzweiflung weint sich die damals 15-jährige Angi bei einer Schulfreundin aus. Deren Grossvater, ein ehemaliger Anwalt, macht sich für die Familie stark, eine Spendenaktion wird gestartet, die Familie darf bleiben.
Ein neues Leben in der Schweiz
In die Schweiz ist Angi der Liebe wegen gekommen. Hier studiert sie Soziale Arbeit. «Es zieht mich dahin zurück, wo ich selber gehadert habe», erklärt sie. Vier Tage die Woche arbeitet sie in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche, daneben kellnert sie in einem Restaurant. Sie kramt ihr Smartphone hervor, streicht über den Bildschirm und bleibt bei Bildern von «ihren Jungs» hängen. Einer hat einen Raubüberfall auf eine Tankstelle verübt. Bei einem anderen wurde schwerer Narzissmus diagnostiziert und er hat Mühe, sich in der Gesellschaft einzuordnen. «Sie sind alle lieb, nur kommen sie aus schwierigen Verhältnissen», sagt Angi.
«Es zieht mich dahin zurück, wo ich selber gehadert habe.»
Ob ihre Jugenderfahrungen bei ihrer jetzigen Berufswahl mitgespielt haben? Unterbewusst habe sie das wohl tatsächlich in diese Richtung gesteuert, meint Angi, aber es sei nicht wirklich ihr Plan gewesen, Sozialarbeiterin zu werden. «Ehrlich gesagt, finde ich es schräg, dass mir genau das gefällt. Jugendliche mit schwierigen Elternhäusern, psychischen Störungen, instabilen Familienverhältnissen.» Sie lacht.
Mittlerweile sei auch die Beziehung zu ihrer Mutter besser geworden, sagt Angi. Je älter sie wurde, desto mehr habe sie ihre Mutter verstanden. Dennoch sei es eine Erlösung gewesen, von ihr wegzukommen. «Ich hatte keine Lust mehr, ihre Biografie mit mir rumzuschleppen.»
Angi drückt ihre Zigarette aus, die Weinflasche ist leer. Auf die Frage hin, was sie heute Abend noch vorhabe, sagt sie zufrieden «schlafen». Morgen muss sie um fünf Uhr aufstehen, um rechtzeitig im Heim zu sein.