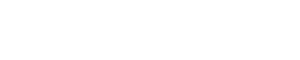Die türkisch-amerikanische Aktivistin Ayşenur Ezgi Eygi war ins Westjordanland gereist, um friedlich gegen den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau und die Siedlergewalt zu demonstrieren. Nach einem Protest schoss ihr ein israelischer Sniper in den Kopf. Unsere Redaktorin hatte Ayşe einige Tage zuvor kennengelernt.
Ich lernte Ayşenur Ezgi Eygi auf meiner Reise nach Palästina kennen. Sie sass mit ihrem Kollegen Ian im selben Grenzbus zwischen Jordanien und dem durch Israel besetzten Westjordanland. Da ich Horrorstorys über stundenlange Vernehmungen durch israelische Grenzbeamte gehört hatte, war ich nervös. Auch Ian und Ayşe schienen aufgeregt. Viel sprachen wir daher nicht. Auch nicht, als wir später gemeinsam in einem weiteren Bus in Richtung Jerusalem an illegalen Siedlungen vorbeifuhren.
Am Abend tourte ich dann mit einem palästinensischen Kollegen durch Jerusalem. Als er mir gerade ein Haus zeigte, welches Israel Anfang der 2000er von seiner Familie gestohlen hatte, hörte ich ein lautes «Hey!». Ayşe und Ian standen vor mir, mit dabei eine weitere US-Amerikanerin. «Wir waren im selben Bus, weisst du noch?», sagte Ayşe fröhlich. Mit der Anspannung der Grenzüberquerung hinter uns kamen wir diesmal schnell ins Gespräch. Wir liefen durch die Altstadt von Ostjerusalem, mein Freund gab uns eine Tour.
Aktivist*innen gehen in Gebiete mit besonders hoher Siedler- und Militärgewalt, um eine Art «Schutzschild» zu bilden.
In einem Cafe unterhielten wir uns anschliessend über Politik. Ayşe erzählte, wieso sie nach Palästina kam: Um die Rechte der Palästinenser zu unterstützen. Sie hatte sich beim International Solidarity Movement (ISM) angemeldet, einer Organisation, die sich im Westjordanland gegen Siedlergewalt, Militärgewalt und Landraub einsetzt. Ihre Strategie: Internationale Aktivist*innen gehen in Gebiete mit besonders hoher Siedler- und Militärgewalt, um dort eine Art «Schutzschild» zu bilden und israelische Überfälle zu dokumentieren und zu verhindern. Ebenso nehmen die Aktivist*innen friedlich an Demonstrationen gegen Landraub teil.
«Ich habe in den USA bereits alles versucht, um den Palästinenser*innen zu helfen», erzählte Ayşe. Sie veranstaltete einen Fundraising-Event, bei dem knapp 48’000 US-Dollar für notleidende Kinder in Gaza zusammenkamen. Sie organisierte Uni-Proteste in ihrer Heimat Seattle und ging an Demos. «Aber das alles hat keine wesentlichen Veränderungen bewirkt», so Ayşe frustriert. Einer der Gründe, weshalb sie nach Palästina gekommen war, war wohl, dass sie «nicht mehr wusste, was sonst noch tun». Ein Gefühl der Machtlosigkeit lag in der Luft.
Langjährige Aktivistin
Am nächsten Tag traf ich Ayşe vor ihrem Hotel im muslimischen Viertel vom illegal annektierten Ostjerusalem. Zeitgleich begannen israelische Soldaten dort, Palästinenser*innen für einen israelischen Marsch von der Strasse zu vertreiben. Ihre Läden wurden geschlossen, Absperrungen wurden errichtet. Jüdische und internationale Passant*innen konnten hingegen weiterhin verkehren.
Ayşe war sichtlich nervös. «Vielleicht sollten wir lieber gehen», meinte sie. Ich fragte einen der Soldaten, was los sei. Er sagte: «Das ist eine Art Party, schaut zu und habt Spass!». Dann rief Ian uns aus einem gegenüberliegenden Gebäude zu sich. Hereingelassen hatten ihn palästinensische Ladenbesitzer. Sie führten uns auf das Dach, von wo aus wir den Marsch beobachteten.
«Komisch, dass er meinte, das sei eine Party», sagte Ayşe. «Die Hotelrezeption sagte, die machen das jeden Monat und es ist sehr gefährlich, ich solle ja nicht rausgehen.» Auch anti-palästinensische Sprüche würden häufig gerufen.
Wir beobachteten den Marsch und gingen danach in ein Café, wo Ayşe erzählte, dass sie bereits 2016 aktivistisch unterwegs gewesen war und an Protesten gegen die Dakota Access Pipeline teilgenommen hatte. Diese richteten sich in Solidarität mit den Ureinwohnern der USA gegen den Bau einer Pipeline. «Wir haben damals mitten im tiefsten Winter in Zeltcamps übernachtet, bei Minusgraden», erinnerte sich Ayşe. Als wir uns unterhielten, war sie 26 Jahre jung. Während der Pipeline-Proteste war Ayşe gerade einmal 18.
Am Folgetag gingen wir Falafel essen. Wir unterhielten uns über die Rolle der USA in Gaza und im Rest von Palästina. Ayşe sagte, ihre Regierung sei am Völkermord an den Palästinenser*innen in Gaza beteiligt, indem sie Waffen lieferte und Israel Straflosigkeit gewährleistete.
Das letzte Treffen
Am nächsten Abend trafen wir uns dann in Ramallah. Während ich den Tag dort mit Sightseeing verbrachte, nahm Ayşe an einem Training von ISM teil. Das 30-seitige Sicherheitsprotokoll las sie im Vorhinein zwei Mal durch. «Es war ganz schön intensiv!», so Ayşe. Während des Trainings wurden Aktivist*innen anderswo im Westjordanland angegriffen. Darüber war sie sichtlich beunruhigt. Dennoch erzählte Ayşe, dass sie plante, am übernächsten Tag zu einer Demonstration nahe Nablus zu gehen. Dass diese gefährlich sei, erwähnte sie ebenso.
«Ich bin hierher gekommen, um zu helfen.»
Ich und ein Freund sagten daraufhin, dass wir am nächsten Tag Sightseeing in Bethlehem machen wollten und danach planten, nach Jericho zu fahren. Mehrfach versuchten wir, sie zu überreden, die Demo ausfallen zu lassen, um mitzukommen. «Ich würde gerne mitkommen, aber ich bin hierher gekommen, um zu helfen», erwiderte Ayşe. Sie war fest entschlossen, sich für die Palästinenser*innen einzusetzen. Auch wenn sie Angst vor ihrem Vorhaben hatte.
Wir fuhren also alleine nach Bethlehem. Am Tag danach fragte ich Ayşe morgens, ob sie mit ins Museum kommen wollte. «Ich fahre an die Demonstration», antwortete sie. «Gib mir Bescheid, wie es läuft», schrieb ich. «Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und hoffe, dass alle sicher bleiben», erwiderte sie. Um 11.58 Uhr schrieb sie dann: «Es hat angefangen». Es war die letzte Nachricht, die ich von ihr erhielt.
Die Ermordung
Gegen 15.30 Uhr folgte der Schock. «Sie haben eine Amerikanerin bei einer Demo in Beita erschossen», sagte ein Kollege plötzlich, als er aufs Handy schaute. Er zeigte mir ein Video. Darauf zu sehen: Ayşe. Tot. Auf einer Krankenhausliege.
Gemäss einer auf Fotos, Videos und Zeugenaussagen basierenden Investigation der «Washington Post» wurde Ayşe um zirka 13.48 Uhr ermordet. Ein israelischer Sniper, der rund 200 Meter entfernt auf einem Haus einer palästinensischen Familie stationiert war, schoss ihr in den Kopf. Dies fast eine halbe Stunde nachdem die friedliche Demonstration gegen illegalen Landraub geendet hatte. Ayşe und die restlichen ISM-Aktivist*innen waren zu diesem Zeitpunkt bereits aufgrund von Tränengas und Schüssen der israelischen Armee vom Zentrum des Geschehens weggelaufen und hatten unter Olivenbäumen Schutz gesucht.
Es war Ayşes erste Aktion in Palästina. Innerhalb von weniger als zwei Stunden wurde sie ermordet. Sie starb unschuldig – so wie die 17 Palästinenser*innen, die seit 2021 im selben Dorf erschossen worden sind. So wie Zehntausende, die seit Oktober in Gaza ermordet wurden und Hunderte, denen im Westjordanland dasselbe Schicksal ereilte.
Keine Konsequenzen
Gemäss Internationalem Gesetz hat Israel kein Recht, das Westjordanland zu kontrollieren, Land zu rauben und friedliche Demonstrant*innen zu erschiessen. Trotzdem kommt Israel seit Jahren straffrei mit diesen Aktionen davon. Beispielsweise tötete die Armee im Jahr 2003 die US-amerikanische ISM-Aktivistin Rachel Corrie, als sie sich vor einen Bulldozer stellte, um gegen Abrisse der israelischen Armee zu protestieren. Sie wurde zu Tode überrollt.
Auch der britische ISM-Aktivist Thomas Hurndall wurde 2003 durch einen Kopfschuss getötet, als er in Gaza ein Friedenszelt auf einer Strasse errichtete, um Panzer der israelischen Armee zu behindern. Nach monatelangem Koma wurde er 2004 für tot erklärt. Nur vier Wochen vor Ayses Tod schoss die Armee auf den US-amerikanischen ISM-Aktivisten Daniel Santiago. Zwar ging der Schuss ins Bein, und Santiago überlebte, dennoch gab es auch bei diesem Vorfall keine Konsequenzen.
Hätte die Welt Internationales Völkerrecht durchgesetzt und verlangt, dass Israel sich aus dem Westjordanland zurückzieht und den Krieg in Gaza beendet – so, wie es der Internationale Gerichtshof fordert – dann würde Ayşe heute noch leben. So wie Tausende andere auch.
Weder die USA noch die EU haben als Antwort auf Ayşes Ermordung Massnahmen wie etwa ein Waffenembargo oder Sanktionen veranlasst. Stattdessen wiederholt die US-Regierung die Behauptungen Israels, dass Ayşe «durch einen Unfall» umgebracht wurde. Die Beweislage ist jedoch klar: Sie wurde gezielt von einem israelischen Sniper ermordet, der sich im besetzten Westjordanland befand, um illegal gestohlenes Land zu verteidigen. Sie wurde getötet, weil sie sich für Menschenrechte und die Einhaltung von internationalem Völkerrecht einsetzte – da es unsere Regierungen nicht tun. Ayşe wurde getötet, weil unsere Regierungen nichts tun.
Kein Einzelfall
Seit Ayşes Ermordung fühle ich vor allem eins: Machtlosigkeit und Wut. Wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bis Israel Internationales Recht einhält? Wieso unternehmen die USA nichts, wenn Israel eine unschuldige US-Amerikanerin ermordet? Wieso überlässt die US-Regierung es Israel, sich selbst zu untersuchen, anstatt eine unabhängige Untersuchung einzuleiten? Seit wann untersuchen Mörder sich selbst?
Seit wann untersuchen Mörder sich selbst?
Dass die fröhliche, weltoffene Ayşe, mit der ich erst vor kurzem noch Zeit verbracht hatte, nicht mehr lebt, habe ich bis heute nicht vollständig realisiert. Auch nicht, nachdem ich mich mit den ISM-Aktivist*innen traf, um einen Olivenbaum für sie zu pflanzen. Auch nicht, nachdem die Frau, die neben Ayşe gestanden hatte, als diese erschossen wurde, mir erzählte, wie sie zu Boden fiel und mit zurückgeklappten Augen aus Nase und Schläfe blutete.
Der Schock sitzt tief. Alleine bin ich damit aber nicht. Tausende von Palästinenser*innen trauern täglich über ihre Familienmitglieder und Freunde, die ebenso sinnlos von Israel getötet wurden. Meine palästinensischen Freund*innen sagten mir deshalb: Nun weisst du, was es heisst, Palästinenserin zu sein. Doch obwohl ich die Brutalität Israels aus erster Hand miterlebt habe, bestreite ich das. Palästinenser*innen haben mit noch viel mehr Unrecht zu kämpfen. Das alles aufzuzählen, sprengt jedoch den Rahmen eines Artikels.