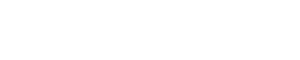In «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer» behandelt Filmemacher Samir sowohl seine eigene wie auch die Migrationsgeschichte italienischer Gastarbeiter*innen. Im Interview spricht er über Ausgrenzung damals und heute, und weshalb er von der Linken enttäuscht ist.
Samir, worum geht es in dem Film?
Ich erzähle meine persönliche Geschichte, wie ich als Flüchtlingskind in die Schweiz gekommen bin, wie ich Gewerkschaftsaktivist wurde, verbunden mit der Geschichte der Migration von Südeuropäer*innen, insbesondere Italiener*innen, in den 60er Jahren. Zudem versuche ich, einen Ausblick auf die heutige Zeit zu bieten. Gegen Ende des Films zeige ich afrikanische Feldarbeiter*innen in Südeuropa. Dort, wo der Film eigentlich begann, mit der Auswanderung der italienischen Arbeiter. Und da schliesst sich der Kreis.

1955 in Bagdad geboren, begann Samir in den 1980ern mit der Produktion von Filmen. Inzwischen hat er über 40 Kurz- und Langspielfilme produziert.
Was hat dich angetrieben, den Film zu machen?
Einer der wichtigsten Gründe ist die Verschärfung der politischen Situation gegenüber Migrant*innen in Europa. Ich habe gemerkt, dass die wenigsten «Bio-Schweizer*innen» von den gesetzlichen und administrativen Auflagen wissen, die die Migrationspolitik bestimmen. Auch meine Tochter war ein ausschlaggebender Punkt. Sie ist 20 Jahre alt und wusste nichts von der neueren Geschichte der Schweiz, die von Migration geprägt ist. Dabei ist sie politisch aktiv, war am Klimastreik und ist in der Queer-Gender-Antirassismus-Bewegung dabei. In der Schule hat man ihr allerdings nichts beigebracht über die Schwarzenbach Initiative oder die Verschärfungen im Asylgesetz.
Der Titel des Films lautet «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer». Wie hat sich die Arbeiterklasse über die letzten Jahrzehnte gewandelt?
Die Arbeiterklasse hatte sich formiert, weil Unterdrückung und Ausbeutung des kapitalistischen Systems Widerstand erzeugt haben. Dieser Widerstand war über 150 Jahre lang politisch sozialdemokratisch vertreten.
Als die ersten Migrant*innen in den 1960er Jahren aus dem mediterranen Raum in die Schweiz geholt wurden, weil es hier eine intakte Industrielandschaft gab, profitierten die Schweizer Arbeiter*innen durch sozialen Aufstieg und Reallohnerhöhungen. Paradoxerweise haben sich damals viele Leute aus den Gewerkschaften dennoch von ihren modernen, progressiven Positionen entfernt – hin zu rassistischen Positionen. Dadurch haben die Gewerkschaften in den 60er Jahren die Migrant*innen, einen wichtigen Teil der Arbeiterklasse, ausgeschlossen.
Als die Schweiz in den 1970 Jahren dann anstatt in die Maschinenindustrie ins Finanzkapital investierte, begann dann der Niedergang der klassischen Arbeiterklasse. Die Fabriken wurden aufgehoben, die Ausländer*innen, die arbeitslos wurden, wurden weggeschickt. Viele Schweizer Facharbeiter*innen wurden in die Frühpensionierung geschickt. So wurde die Schweizer Arbeiterklasse praktisch abgeschafft.
In den 90er Jahren haben einige Funktionäre aus den Restbeständen der alten Gewerkschaftsbewegung dann eine neue Gewerkschaftsbewegung formiert. Inzwischen ist die stärkste Gewerkschaft die Unia – sie ist mit zwei Drittel Ausländer*innen auch eine wichtige Vertreterin von Migrant*innen geworden.
Im Film sprichst du im Hinblick auf die Ausgrenzung italienischer Arbeiter*innen von einer «stillen Apartheid». Woran würdest du diese ausmachen?
Früher hat sich das durch die Ausgrenzung von Italiener*innen, die in Baracken leben mussten, ausgedrückt. Heute haben wir einen viel clevereren Stil der Ausgrenzung. In gewissen Gemeinden wird durch Steuern und Zustimmungen kontrolliert, wer dort hinziehen kann und wer nicht.
Vielen Ausländer*innen gibt man zudem keinen Schweizer Pass mehr. Wir haben 2,5 Millionen Menschen, die in den Unterschichten rechtlos schuften müssen. Wegen neuer Bestimmungen können ihre Aufenthaltsrechte jederzeit gekippt werden. Selbst das ständige Aufenthaltsrecht (C Bewilligung) kann widerrufen werden. Die Menschen müssen zittern, haben Angst, dass sie sozial absteigen könnten und arbeitslos werden – was dann direkt einen Einfluss auf das Aufenthaltsrecht hat. Und das ist eigentlich eine stille Apartheid, wenn man nicht gleichwertig behandelt wird wie andere.
Der Arbeiterklasse gegenüber stellst du die Expats.
Genau. Die Expats sind Fachkräfte des globalen Kapitals, sozusagen die «Söldner» des globalen Kapitals. Es sind die Finanzfachleute, IT-Fachleute, Spezialisten im Organisationsbereich, KPMG, Pricewaterhouse – all diese Leute kann man Expats nennen. Sie werden dorthin versetzt, wo sie benötigt werden, oft zu ihren Gunsten. Diese Leute interessieren sich nicht unbedingt für das Umfeld, in dem sie leben, sie wollen sich an der Profitmaximierung beteiligen. Ausländer*innen übernehmen hingegen die Jobs der früheren Arbeiterklasse. Sogar wenn sie unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, werden Expats privilegiert behandelt gegenüber ausländischen Unterschicht-Arbeiter*innen, die die Toiletten putzen, in der Gastronomie, Landwirtschaft oder im Care-Bereich arbeiten.
Du kritisierst in deinem Film auch die Rolle der Medien und wie rassistisch damals über Italiener*innen berichtet wurde. Beispielsweise wurden sie als «Messerstecher» bezeichnet, die Frauen belästigen würden. Hat sich die Berichterstattung verbessert?
Verbessert hat sich nichts – im Gegenteil. Die Blick-Schlagzeilen, die ich in meinem Film aufzeige, wurden damals fast immer in der Möglichkeitsform gehalten – im Vergleich zu heute waren sie geradezu nett. Das ist verblüffend zu sehen. Die Medien tragen Rassismus und Unterstellungen gegenüber migrantischen Menschen auch heute noch weiter.
Wie kam der Wandel von Italiener*innen als Feindbild hin zu Träger*innen der populären Kultur?
Ich denke, in dem Moment, als die Italiener anfingen, sich selbst zu organisieren, entwickelten sie eine Parallelgesellschaft. Als diese Strukturen immer grösser wurden, strahlten sie auf die schweizerische Gesellschaft aus, was zu einem Kulturwandel führte. Es ist kein Zufall, dass Spaghetti Al Dente inzwischen ein Schweizer Begriff geworden ist. Diesen Kulturtransfer, den ich für positiv halte, hat es schon immer gegeben. Und das muss nicht unbedingt über Gewerkschaften und politische Organisationen laufen, sondern geschieht auch über die Fähigkeit der Menschen, sich nicht kleinmachen zu lassen, sondern ihre Kultur weiterzuleben.
Wer sind die «neuen Italiener»?
Heute gibt es keine entsprechende Homogenität mehr. Auf dem Bau dominieren die Portugiesen, im Care-Bereich setzen sich Leute aus Deutschland und aus dem ehemaligen Ostblock zusammen. In der Gastronomie gibt es viele Kurden. Solange diese Unterschichten sich nicht bewusst definieren und zusammentun, um die Gesellschaft zu ihren Gunsten zu verändern, solange wird es auch keine Arbeiterklasse geben. Stattdessen werden sie Ausländer*innen bleiben.
Es gibt immer wieder Abstimmungen zum Thema Migration. Was sind deine Gedanken und Sorgen diesbezüglich?
Die letzte positive linke Initiative für Menschenrechte (Mitenand-Initiative) wurde vor über 40 Jahren eingereicht. Seither existiert das Thema Migration für die Linke praktisch nicht. Sie überlässt das Feld rassistischen Rechten, und hat Angst, das Wort «Migration» auch nur schon in den Mund zu nehmen. Ich bin im Komitee der 4‑Viertel-Initiative, um für Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land zu kämpfen, damit sie die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Dass die Linken, die sich eigentlich für Gleichberechtigung einsetzen sollten, hier nur Lippenbekenntnisse machen, ist deprimierend.
Die 2,5 Millionen Menschen, die keine Rechte haben, werden links liegen gelassen – gerade weil sie keine Bürger*innenrechte haben und für Politiker*innen als Wählerschaft uninteressant sind. Das ist völlig absurd. Dass wir als Migrant*innen in diesem Land auch bei der Linken nicht auf Interesse stossen, ist mir erst bei der Arbeit an diesem Film bewusst geworden.