Gastautorin Melina Stavrinos war vor fünf Jahren als freiwillige Helferin im Geflüchtetenlager auf Samos. In ihrer Reportage kehrt sie an den Ort zurück.
Jetzt stehe ich wieder hier. Auf diesem hässlichen Hügel, der auf der ansonsten malerischen Insel Samos so surreal erscheint. Ich stehe da, inmitten der Misere, die faulig-feucht und verbrannt riecht und schaue hinunter auf die Ägäis. Dieser Blick löste in mir immer ein Gefühl der Freiheit aus. Dieses bis an den Horizont grenzende Blau erinnerte mich daran, wie klein und unbedeutend ich und meine Sorgen im Vergleich zur wuchtigen Natur sind.

Für die Menschen, die hierher geflüchtet sind, muss sich der Blick aufs glitzernde Mittelmeer gewaltig anders anfühlen. Sie werden an ihre oftmals lebensbedrohliche Reise erinnert und daran, dass es unmöglich ist, sich aus dieser von Wasser umgebenen Festung zu befreien.
Die Menschen, die hierher geflüchtet sind, werden von der EU im Stich gelassen.
Sie werden von der EU und den griechischen Behörden im Stich gelassen, dabei träumten sie von einer besseren Zukunft oder fürchteten um ihr Leben. Die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, die Resignation spiegelt sich in so manchem Augenpaar wider, in das ich blicke. Genau wie damals, als ich vor knapp fünf Jahren dem Leid zum ersten Mal gegenüberstand.
Ein ganz normaler Tag
Ich werde von Natasha, die für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, durch den «Dschungel» geführt. Der Dschungel ist nicht mehr als ein Hang mit Bäumen, direkt am Stadtrand der Inselhauptstadt Vathy, neben dem offiziellen Geflüchtetenlager. Die meisten der rund 2’000 Geflüchteten, die zurzeit auf Samos festsitzen, leben hier, weil das offizielle Lager nur 648 Plätze bietet. Wir begegnen vielen Menschen, wir grüssen uns gegenseitig. «Salam. Salam.» «Ça va, mon frère? Salut, ma soeur.» Dabei versuche ich den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie nicht zu bemitleiden und ihnen dennoch mein Mitgefühl auszudrücken, ihnen wortlos zu sagen: «Du bist nicht alleine, ich sehe dich und schäme mich dafür, was dir angetan wird. Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun. Es tut mir leid, dass ich es nicht kann.»
«Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun. Es tut mir leid, dass ich es nicht kann.»
Gleichzeitig versuche ich, mir nichts anmerken zu lassen. So zu tun, als sei es ein ganz normaler Tag. Denn für viele der Geflüchteten ist es ein ganz normaler Tag. Doch für mich ist es kein normaler Tag. Für mich ist es ein besonderer Tag, an dem ich das Privileg habe, nicht nur über die Schande Europas zu lesen, sondern sie mit all meinen Sinnen zu spüren. Ich habe das Privileg, für einige Stunden durch den Schlamm und Müll zu stapfen, die Hässlichkeit der Krise zu beäugen und darüber zu staunen, dass Menschen Fitnessgeräte, religiöse Stätten oder Brotöfen aus dem Boden gestampft haben.
Natasha nimmt mich mit in die kongolesische Kirche, in der jeden Morgen ein Gottesdienst stattfindet. Sie nehme sehr gern teil, wenn es die Zeit zulasse, sagt sie. Es sei eine besondere Stimmung im Raum, wenn die Menschen gemeinsam singen und für einen kurzen Moment gemeinsam hoffen und beten. Die Energie im Raum ist spürbar, obwohl Natasha und ich alleine sind. «Sie versuchen sogar den Mindestabstand einzuhalten», sagt sie und deutet auf die farbigen Plastikhocker, die im Zelt aufgestellt sind. Ich finde es schön, dass sich die Menschen diese Insel geschaffen haben. Und gleichzeitig ist es einfach nur traurig, dass so eine improvisierte Kirche, die absolut nichts mit einer Kirche zu tun hat, wie wir uns sie vorstellen, das Tollste hier sein soll. Bei uns würden Gläubige es kaum toll finden, ihre religiösen Zeremonien in einem Zelt, das im Sommer einem Treibhaus gleicht, durchzuführen. Aber für die hier, soll das toll sein.
Ungeschickt versuche ich, Natasha am steilen Hang über das Geröll zu folgen, ohne dabei ständig in Schlamm oder Müll zu treten. Wir bleiben bei einem Mann stehen, der Natasha um Rat fragt. Sein Nachbar oberhalb hat für die Verrichtung der Notdurft eine Latrine gebaut. Doch wegen des Regens läuft ihm deren Inhalt nun direkt ins Zelt. Er spricht Farsi, Natasha Arabisch. Ich spreche gar nichts von beidem, aber das ist auch nicht notwendig. Man kann das Problem sehen und riechen. Mit wenigen Wortfetzen und viel Zeichensprache erklärt Natasha dem Mann, dass sie sein Anliegen weiterleiten werde.
Erinnerungen kommen hoch
«Kannst du irgendwo die Rattenfalle mit der Nummer 64 sehen?», fragt mich Natasha. Die Rattenfalle Nummer 64 wäre tatsächlich meine erste Rattenfalle, da ich noch nie zuvor eine gesehen habe. Deshalb weiss ich zunächst gar nicht, wonach ich Ausschau halten soll. Ich schaue etwas unbeholfen herum und finde leider nur Rattenfalle Nummer 62.
Natasha erklärt mir, dass Ärzte ohne Grenzen die Rattenfallen systematisch aufgestellt, sie regelmässig leert und wieder mit Gift füllt. Das Problem sei, dass einige Bewohner*innen die Fallen direkt vor ihre Zelte stellten, um sich und ihre Familien besser vor Bissen in der Nacht zu schützen. Die Crew findet diese dann nicht mehr und kann sie demnach nicht mehr regelmässig leeren und wieder mit Gift füllen. Obwohl Natasha eigentlich Gesundheitspromoterin ist, beschäftigen sie die Rattenfallen täglich. Rattenfallen suchen, Rattenfallen finden, Rattenfallen-Verschiebungen melden, über Rattenfallen-Verschiebungen aufklären. Mir fällt ein, mit wie vielen solchen scheinbaren Banalitäten auch ich während meiner Zeit bei der NGO Samos Volunteers konfrontiert war. So etwas steht nicht im Jobbeschrieb und so etwas schildert man auch im Nachhinein nicht als Erfahrung. Und doch sind genau solche Aufgaben so zeitintensiv.
«You have shoes for baby?”, fragt mich eine Frau, als wir die Mitte des Dschungels erreicht haben und Natasha gerade einem Mann die Telefonnummer einer Anwältin gibt, da er in wenigen Tagen ein Asylinterview haben wird. Die Frau zeigt auf ihren Sohn, den ich auf zwölf Jahre schätze. Er sieht ganz und gar nicht aus wie ein Baby und ich muss innerlich ein wenig schmunzeln.
«You have shoes for baby?», fragt mich eine Frau und zeigt auf ihren Sohn, den ich auf zwölf Jahre schätze.
Und ich weiss, dass ich wieder hier bin, denn es gibt kaum eine Frage, die ich in Vathy öfter gehört habe. Es gibt auch kaum eine Frage, die mich so wahnsinnig macht wie diese. Denn wer bin ich, darüber zu entscheiden zu können, ob jemand Schuhe an den Füssen hat oder nicht? Was gibt mir dieses Recht? Weshalb soll ich diese Macht haben? Und wieso muss ich ständig «Nein» sagen, wo ich doch hierher gekommen war, um «Ja» sagen zu können? Wie muss es sich wohl für die Betroffenen anfühlen, plötzlich so abhängig zu sein und nach Kleidung, Essen oder Decken zu fragen? Ich bin froh, diese Entscheidungen nicht mehr treffen zu müssen.
Es ist und bleibt einfach schlimm
Während sich eine Traube wartender Menschen um Natasha gebildet hat, stehe ich da mit meinem Notizbuch und schaue Richtung Boden. Ich schäme mich dafür, ein paar Stunden in den würdelosen Alltag dieser Menschen einzudringen, nur um bald wieder zu gehen. Ich will nicht noch sensationslustig dabei aussehen. Und dennoch versuche ich ganz bewusst wahrzunehmen, was um mich herum geschieht. Die Durchsagen, die permanent und unverständlich über die Lautsprecher ertönen, vermischen sich mit französischer und arabischer Musik, die aus den Handys vorbeigehender Menschen erklingt. Kinder schlurfen gelangweilt herum, eine junge Frau geht vorbei, auf dem Kopf trägt sie einen gefüllten Wasserkanister. Dreckiger Wind weht mir ins Gesicht und bleibt an meinen Haaren und meinen Kleidern haften. Die Stimmung, die hier herrscht, ist schwer in Worten zu fassen. Spürbar sind sowohl die Spannung, die in der Luft liegt, wie auch die Hoffnungslosigkeit, die mich schier erdrückt.
«Es ist nicht mehr oder weniger schlimm als zuvor, es ist einfach anders schlimm», sagt Natasha auf meine Frage, ob die Situation sich gebessert habe, seit nicht mehr 8’000 sondern nur noch zirka 2’000 Menschen im und rund ums Lager leben, weil aufgrund der Pandemie viele aufs Festland gebracht worden waren. Schon während einer Einsätze 2016 und 2017 war die Situation sowohl auf den Inseln wie auch auf dem griechischen Festland schlimm.
Wer in so kurzer Zeit kein Geld für eine Bleibe auftreiben kann, wird obdachlos.
Schlimm ist auch der Gedanke daran, dass die Menschen neue Hoffnung schöpfen, wenn sie den Bescheid erhalten, nach Athen gehen zu können. Nur um dann zu merken, dass sie von der griechischen Hauptstadt verschluckt werden. Denn seit einigen Monaten werden in Athen Zwangsräumungen durchgeführt: Auch Kinder, Betagte, Schwangere oder Kranke landen auf der Strasse. Wer offiziell als Geflüchtete*r anerkannt wird, muss innerhalb von 30 Tagen die Unterkunft verlassen. Wer in so kurzer Zeit kein Geld für eine Bleibe auftreiben kann, wird obdachlos.
Natasha zeigt mir eine Fitnessanlage, die aus alten Auto- und Veloreifen, Zahnrädern, Ästen und Pet-Kanistern zusammengebaut wurde. Wir grüssen den Mann, der in Natashas Lieblingsshop Zigaretten und Eistee unter einer Plane verkauft und winken dem Coiffeur zu, der ihr den Sidecut schneidet. Als sie mich fragt, ob wir fürs Mittagessen ins Büro in der Stadt zurückkehren wollen, nicke ich dankend. Genauso wie ich das Privileg habe, mir das Lager mit eigenen Augen anzusehen, habe ich auch das Privileg zu entscheiden, dass ich jetzt gehen will. Ich entscheide, wann ich genug gesehen habe, wann ich essen und trinken will, und wann ich nach Hause gehen möchte. Die Menschen, die hier leben, können nichts von all dem selbst entscheiden. Teilweise stehen sie stundenlang Schlage, um ein krankmachendes, ungeniessbares Essen zu erhalten. Einige müssen monate- oder sogar jahrelang warten, bis entschieden wird, ob und wo ihnen Asyl gewährt wird oder nicht.
Dieser Wahnsinn muss aufhören
Zuhause wasche ich mir mit warmem Wasser den Schmutz ab, der an meiner Haut und an meinen Haaren klebt. Meinen Schmerz, den ich beim Anblick dieser Katastrophe spüre und der mich leicht benommen macht, werde ich jedoch nicht los.
Während ich zurück in Winterthur diese Zeilen schreibe, geht der wahrgewordene Albtraum für Tausende von Menschen nur 1’500 Kilometer südlich von hier weiter. Kinder spielen mit zufällig gefundenen Gegenständen im Dreck, statt zur Schule zu gehen. Frauen verschanzen sich aus Angst in ihren Zelten, anstatt nachts zur Toilette zu gehen. Männer werden aufgrund ihrer Hautfarbe systematisch zu Opfern der Polizei, anstatt einer Tätigkeit nachgehen zu können.
Kinder spielen mit zufällig gefundenen Gegenständen im Dreck, statt zur Schule zu gehen.
Jetzt käme die Stelle, die wenigstens ein bisschen hoffen lässt. Aber das hier, das ist keine Geschichte, sondern die bittere Realität, die sich in diesem Moment auf den griechischen Inseln abspielt. Das ist der Alltag jener Menschen, die auf ein besseres Leben gehofft und nun zum Opfer der europäischen Migrationspolitik geworden sind. Zu viele Menschen hat die Hoffnung schon verlassen. Letztes Jahr hat Ärzte ohne Grenzen in Samos 2’352 psychologische Konsultationen durchgeführt. Einige der Patient*innen wurden als akut suizidgefährdet eingestuft. Meine Gedanken sind bei all den Betroffenen, die den Glauben ans Gute verloren haben. Mir bleibt nur zu hoffen, dass dieser wahrgewordene Albtraum eines Tages aufhören wird.
Melina Stavrinos war 2016 als Helferin im Geflüchtetenlager auf der griechischen Insel Samos tätig. Heute ist sie Kommunikationsexpertin bei Ärzte ohne Grenzen.
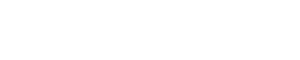

ja, der dreck, welcher auf dem herzen und in der seele klebt, lässt sich weder mit wasser noch mit seife abwaschen. ich schäme mich dafür, dass ich nicht mal richtig hinsehe, keine hilfe anbiete und einfach tatenlos in meiner kleinen bubble lebe und so oft auf hohem niveau jammere. ich kann das elend durch deine worte riechen und fühlen, ich fühle mich ohnmächtig — “ohne macht”, etwas an diesem leid ändern, die welt retten zu können. melina, du bist ein grosses schreibwunder und ein grosses geschenk für diese welt. umarmig
Danke Melina, das Unfassbare in Worte zu packen und diesen Leben einzuhauchen. Auf Worte können Taten folgen. Wünschen wir uns, dass bald Taten folgen!