Havin ist 19, als sie von Bern in den Irak reist. Dort wird ihr die Rückkehr in die Schweiz verwehrt; sie wird gezwungen, einen ihr unbekannten Mann zu heiraten. Noch heute kämpft sie um Normalität im Alltag.
Du hast Teil 1 bereits gelesen? Hier gelangst du direkt zu Teil 2, Teil 3 oder Teil 4 des Beitrags.
Eigentlich ist das Schlimmste vorbei. Trotzdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Gedanke in Havins* Kopf aufblitzt, der sie wie eine Zeitmaschine in die Vergangenheit holt. Zum Beispiel wenn jemand fragt, wie es ihren Eltern gehe, und sie keine Antwort weiss. Oder wenn sie im Sommer an den weissen Plastikstühlen vor der Dönerbude vorbeigeht. Dann sitzt sie in Gedanken selbst wieder auf einem weissen Plastikstuhl, in einem Brautkleid, das ihr nicht gefällt, für einen Mann, den sie niemals heiraten wollte.
Statt im Irak, in einem kleinen Dorf nahe der türkischen Grenze, sitzen wir nun in einem Büro in Bern. Statt auf weissen Plastikstühlen auf einem schwarzen Ledersofa. Rund sieben Jahre sind seither vergangen. «Ich war damals ganz anders», erklärt die 27-Jährige. Sie sei «schwach» gewesen, habe immer wieder ein Auge zugedrückt oder zwei. Deshalb habe man auch so viel Macht über sie gehabt. «Ich war Futter für Leute wie meinen Ex-Mann und meine Familie. Ich war die Art von Mensch, die man in der Schule mobbt, weil sie nie etwas sagen.»
Ihr fast scheuer Blick und das schüchterne Lächeln lassen vermuten, was sie damit meint. Die von langen Wimpern umrahmten Augen blicken freundlich, gutmütig. Havin wirkt wie jemand, von dem niemand etwas befürchten muss. Ihr Gesicht ist hell mit hohen Wangenknochen, die Gesichtszüge weich. Schwarzes Babyhaar umrahmt ihre weisse Stirn. Den Rest des Haares hat sie hinten zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden. Während des Gesprächs entschuldigt sich Havin mehrmals – bei der Wahl der Getränke, des Sitzplatzes, möchte, wie sie sagt, keine Umstände machen.
«Heute bin ich jedoch ein anderer Mensch», beteuert sie mit fester Stimme, und ein wenig leiser fügt sie hinzu: «Vielleicht musste ich all diese Erfahrungen machen, damit ich aufwachen konnte, damit ich Nein sagen konnte.»
«Ich war die Art von Mensch, die man in der Schule mobbt, weil sie nie etwas sagen.»
In der Schweiz werden laut offiziellen Angaben bis zu 700 Jugendliche und junge Erwachsene jährlich zwangsverheiratet, die Dunkelziffer ist hoch. Vier von fünf Betroffenen sind Frauen, 28 Prozent jünger als 18 Jahre.
Die Erfahrungen, von denen Havin spricht, klingen erst einmal surreal: Verschleppung in den Irak. Zwangsheirat. Vergewaltigung. Häusliche Gewalt. In dieser Kombination nicht wirklich etwas, was sich beim Nachbarn gegenüber abspielt. Und dennoch werden in der Schweiz laut offiziellen Angaben bis zu 700 Jugendliche und junge Erwachsene jährlich zwangsverheiratet, die Dunkelziffer ist hoch. Die Opfer stammen mehrheitlich aus Sri Lanka, Kosovo, Albanien, Mazedonien, der Türkei, Afghanistan und Syrien. Bei den meisten handelt es sich um Mädchen.
Havin ist eines davon. Sie wächst mit sieben Geschwistern in einem Vorort in Bern auf. Der Vater, ein ehemaliger Peschmerga, hatte im Irak für einen unabhängigen Kurdenstaat gekämpft. Nachdem das Regime Saddam Husseins ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte, flüchtete er mit Havins Mutter in den Iran. Dort lebte das Paar rund zehn Jahre unter falscher Identität, indem es seine kurdische Herkunft verheimlichte und sich als irakisch ausgab. Beim Ausbruch des Ersten Golfkriegs zwischen dem Iran und dem Irak mussten Havins Eltern dann erneut flüchten. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in der Türkei erhält die Familie 1989 politisches Asyl in der Schweiz. Hier kommt Havin 1991 zur Welt.
Ihr Vater sei schon immer sehr streng gewesen, erzählt sie, und natürlich hätten auch ihre älteren Schwestern Probleme mit ihm gehabt, «doch die beiden haben nicht auf ihn gehört, waren mit jemandem zusammen und sind schliesslich abgehauen». Havin erinnert sich, wie sich die älteren Schwestern gegenseitig deckten, wenn sie nachts aus dem Haus schlichen, um sich mit Freunden zu treffen oder in Clubs und Bars zu gehen. «Damals waren ja diese Gummibänder aus künstlichem Haar im Trend», erzählt Havin. «Die haben sie jeweils aufs Kopfkissen gelegt, damit es aussah, als läge jemand im Bett.» Unter die Bettdecke kamen zusammengeknüllte Kleider; der Vater habe nie etwas gemerkt.
Doch Havin ist anders, sie ist keine Rebellin. Sie traut sich nicht, den Weg ihrer Schwestern zu gehen, denkt, man brauche die Familie, um glücklich zu sein. Dabei hätte die Manipulation durch ihre Eltern früh begonnen. Schon bald nach Eintritt in die Mittelschule muss sie diese auch schon wieder verlassen. Die Schule befindet sich in Neuenburg – für Havins Vater eine zu grosse Distanz zum Wohnort. «Das hat ihm nicht gepasst», sagt sie mit einem gequälten Lächeln, «er dachte, ich würde dort mit Jungs abhängen.» Dabei habe sie sich auf die Schule gefreut: «Ich liebte Französisch und dachte, ich könnte die Sprache dort fliessend lernen.» Havin muss regelmässig ihren Stundenplan zu Hause vorweisen. Der Vater möchte die Kontrolle haben. Und irgendwann ist auch das nicht genug.
«Ich war eine Arbeitseinkommenstochter.»
Statt ihren Abschluss zu machen, fängt Havin an, in einem kleinen Lebensmittelladen zu arbeiten – der Chef ist ein Freund ihres Vaters. Den bescheidenen Lohn muss sie zu Hause abgeben. Ein leichter Anflug von Ärger wird in ihrer bisher gefassten Stimme hörbar: «Ich war eine Arbeitseinkommenstochter. Mein Vater meinte immer, er habe sehr hohe Kosten wegen mir. Jetzt, wo ich selbst Rechnungen bezahle, weiss ich natürlich, dass die Miete und Krankenkasse niemals 3’500 Franken gekostet haben.» Mit 17 sei ihr das nicht bewusst gewesen.
Irgendwann hat Havin genug von der Arbeit im Supermarkt. Sie möchte nicht ständig ihren Vater um Geld fragen, möchte sich auch mal neue Kleider oder Make-up kaufen. Sie wehrt sich auf ihre eigene, stille Weise – indem sie unzuverlässig wird, zu spät zur Arbeit erscheint und schliesslich die Kündigung kassiert. Wenig später sei dann auch schon der Anruf aus dem Irak gekommen.
«Falls es passt, wird es bald eine Hochzeit geben.»
Ein Freund ihres Vaters ist für seinen Enkel auf der Suche nach einer Braut. Havin ist 19, als ihr Vater eines Abends zu ihr ins Zimmer kommt, ihr von dem jungen Mann im Irak erzählt. Die Familie sei sehr angesehen im Dorf, der Grossvater ein anständiger Mann. Der Vater schlägt vor, mit ihr ins Heimatdorf zu reisen und den Mann persönlich kennenzulernen: «Falls er dir nicht gefällt, kehren wir zurück und vergessen das Ganze, doch falls es passt, wird es bald eine Hochzeit geben.» Wo das frisch getraute Paar später leben sollte, würde man dann sehen.
Havin lacht kurz auf, als sie die Szene schildert. Es klingt bitter. Sie habe dem Plan zugestimmt und sei mit ihrem Vater in den Irak geflogen. Hättest du nicht einfach Nein sagen können, Havin? Du bist in der Schweiz geboren, aufgewachsen, weshalb kam eine arrangierte Ehe überhaupt in Frage? «Es klingt blöd, doch ich wollte meinen Vater stets stolz machen», sagt sie nach einer kurzen Pause. «Ich wollte, dass er sich um mich kümmert, sich um mich sorgt. Ich habe versucht, mir seine Liebe zu verdienen.»
Dabei sei selbst ihre Mutter gegen die Reise gewesen, habe sich mit dem Vater gestritten, «Bring sie nicht!» gefleht. Dieser habe nur gemeint: «Wegen deiner anderen Töchter haben wir unser Gesicht verloren. Sie soll nun versuchen, unseren Ruf wiederherzustellen.» Als Havin und ihr Vater die Wohnung verlassen, um zum Flughafen zu fahren, verabschiedet sich die Mutter nicht.
«Du passt zu uns! Wir werden uns gut um dich kümmern.»
Im Irak, bei der Familie des Mannes angekommen, wird Havin dann das erste Mal misstrauisch. «Du passt zu uns!», wird sie von den Frauen empfangen, und: «Wir werden uns gut um dich kümmern!» Wenig später lernt sie ihren zukünftigen Ehemann kennen; am Hinterausgang des Hauses will er sich mit ihr treffen.
Havin erinnert sich, vom ersten Augenblick an eine Abneigung gespürt zu haben: «Der erste Eindruck war nicht gut. Da war keine Sympathie vorhanden, da waren keine positiven Gefühle. Ich wusste sofort, aus uns wird das nichts.» Der Mann ist drei Jahre älter als Havin, 22, und Polizist im benachbarten Dorf. Havin beschreibt ihn als gross und «extrem dünn». An den Inhalt ihres ersten Gesprächs kann sie sich heute nicht mehr erinnern, in ihrem Kopf sei es vor Anspannung wie zugefroren gewesen.
«Wir hatten nur einen kurzen Moment lang Blickkontakt, dann sah er nur noch auf den Boden», erzählt sie. In dieser Zeit habe sie Gelegenheit gehabt, ihn näher zu mustern. Sein Gesicht sei dünn und eingefallen gewesen, die Haut unrein, die Zähne bräunlich verfärbt. Havin verbirgt nur mühselig das Unbehagen, das die Begegnung noch heute in ihr auslöst. «Als er sprach, fiel mir auf, dass er Mundgeruch hatte», sagt sie. Später, im Bett, sei es noch viel schlimmer gewesen. «Der Geruch war überall. Ich bekam ihn kaum aus meiner Nase, von meinem Körper.» Und fast so, als müsste sie sich rechtfertigen, fügt sie hinzu: «Es war nicht nur das Aussehen; die Hygiene, seine Redensart – nichts hat gepasst.»
«Ich wusste sofort, aus uns wird das nichts.»
Am selben Abend wird Havin ins «Männerzimmer» gerufen. Der Holzboden ist mit weichen, gemusterten Teppichen ausgelegt, in der Ecke steht ein Fernseher. Der Grossvater des Bräutigams, ein Onkel der Familie und ihr Vater sitzen einander in prunkvollen Sofas gegenüber. Die Wände sind mit Kalaschnikows und Bildern von bewaffneten Kämpfern in Militäruniform geschmückt. Havin wird aufgefordert, ihren Pass zu holen und ihn den Männern zu übergeben. Die machen keinen Hehl aus ihrem Plan: Ihr Pass soll verbrannt werden, die künftige Braut bloss nicht auf die Idee kommen, die bevorstehende Hochzeit aufzulösen. Stattdessen soll sie im Irak unter Kontrolle der Schwiegereltern leben. Havin stockt, steht wie angewurzelt auf dem weichen Teppichboden, während sich die Gedanken in ihrem Kopf wie Blätter im Sturm überschlagen. Sie schaut zögernd zu ihrem Vater, doch dieser nickt nur auffordernd, und sein Blick lässt keinen Widerspruch zu, als hätte er sich mit den Männern im Raum und den Kämpfern an der Wand verbündet.
«Ich habe das Ganze gehört und mich nicht getraut zu widersprechen», sagt Havin mit blasser Stimme. Von ihrer Mutter habe sie gewusst, dass im Irak nicht selten Frauen getötet wurden, die es wagten, sich der Familie zu widersetzen. «Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ins Hinterzimmer eines kriminellen Rings gestossen. Du bist plötzlich von einer Männerbande umzingelt und musst ohne Wenn und Aber ihre Anweisungen befolgen – auch wenn sie sich das Recht nehmen, dir deine Identität zu nehmen.»
Havin holt ihren Pass und händigt ihn wortlos dem Grossvater aus. Doch der Pass ist dick, will nicht brennen, weshalb ihn der alte Mann Seite für Seite übers Feuerzeug hält, bis das Dokument komplett in Flammen aufgeht. «An die erste Seite kann ich mich besonders gut erinnern», sagt Havin, «die mit dem Namen und dem Foto drauf, mit der Folie darüber». Die Plastikfolie habe sich in den Flammen gekrümmt und schmerzhaft in sich zusammengezogen. Sie habe das Foto verzerrt und mitsamt dem Namen verschluckt.
«Mit der Reise war schon alles beschlossen.»
Havin beschliesst, unter vier Augen mit ihrem Vater zu sprechen. «Hatten wir nicht vereinbart, ich könne selbst entscheiden?», fragt sie ihn später. «Hattest du nicht gemeint, wir könnten einfach wieder zurückfliegen, wenn es nicht passt?» «Nein», lautet seine Antwort, «mit der Reise war schon alles beschlossen.» «Erst da wurde mir klar, dass es für mich hier nichts zu entscheiden gab», sagt Havin, «ich sollte diesen Mann heiraten und von nun am im Irak leben.»
Teil 2
Ihr Verlobter arbeitet als Polizist in einem anderen Dorf. Dort bleibt er jeweils eine Woche, dann kehrt er für eine weitere wieder nach Hause zurück. Havin wohnt im Haus seiner Familie – dem Vater, dessen beiden Frauen und deren Kindern. Kommt Besuch, wird sie aufgefordert, sich zurechtzumachen und zu schminken, die neue Schwiegertochter soll schliesslich hübsch aussehen.
Im Haus der Schwiegereltern kommt es bald zum ersten Streit. Havin merkt, dass aus ihrem Koffer Dinge fehlen. Die Schwester ihres Zukünftigen hat sich bei ihrer Unterwäsche bedient, sein Bruder ihr Parfum mitgehen lassen. Havin beschliesst, hier eine Grenze zu setzen, ihren Koffer mit dem kleinen Rest Vergangenheit darin zu verteidigen. Wenn sie schon bei den grossen Entscheidungen nicht mitreden konnte, will sie wenigstens auf die kleinen beharren. Sie nimmt ihren Mut zusammen und erzählt ihrem Verlobten, was vorgefallen ist. «Ich habe gesagt, das würde ich nicht akzeptieren, habe gedroht, die ganze Hochzeit abzublasen», sagt sie mit einem gequälten Lächeln. «Dabei wusste ich, dass ich nichts in der Hand hatte.» Auch ihr zukünftiger Mann scheint dies zu wissen. Unbeeindruckt meint er: «Deine Sachen sind auch unsere Sachen.»
«Das war der Moment, in dem ich anfing, ihn zu hassen.»
Sie habe sich in diesem Moment noch machtloser gefühlt, als sie es ohnehin schon gewesen sei, erinnert Havin sich. «Ich durfte nicht einmal meine eigene Unterwäsche besitzen.» Der Mann macht ihr auch deutlich, dass er es nicht toleriert, wenn schlecht über die Familie gesprochen wird. «Da habe ich gemerkt, mit dem kann man nicht reden, der versteht rein gar nichts», sagt sie. «Ich glaube, das war der Moment, in dem ich anfing, ihn zu hassen.»
Die Hochzeit findet völlig unangekündigt drei Wochen später statt. Havin fragt, ob sie mitreden darf, ob sie sich die Haare machen und ein Hochzeitskleid aussuchen kann. «Ich weiss nicht mehr, ob ich sie überredet hatte oder ob sie einfach nur Mitleid mit mir hatten», sagt sie, «jedenfalls durfte ich mir in einem Laden ein Kleid aussuchen.»
Weshalb war dir das Brautkleid so wichtig, Havin? Warum wolltest du schön sein für eine Hochzeit, die du niemals gewollt hast? Havin schweigt einen Moment, dann sagt sie: «Ich wusste, ich würde mein Leben hier verbringen. Ich wusste, hier gab es keinen Weg raus.» Gedanken an eine mögliche Flucht habe sie beiseitegeschoben, nachdem ihr Pass verbrannt worden war, und sie realisierte, dass es im Irak keine Schweizer Botschaft gab. «Hätte es eine Schweizer Botschaft gegeben, wäre vieles einfacher gewesen. Dann hätte ich sagen können: ‹Ich haue ab.› Aber die gab es nicht. Und die deutsche Botschaft war drei Autostunden von dem Ort entfernt», erklärt Havin. «Ich hatte keine Ahnung, wie ich ohne Hilfe dorthin kommen konnte und ob sie mir auf der Botschaft überhaupt helfen würden.» Für sie sei das Kleid ein Versuch gewesen, Normalität in den Wahnsinn zu bringen.
«Das Kleid war der Versuch, Normalität in den Wahnsinn zu bringen.»
Das Ausmass des Wahnsinns beginne ich erst später zu begreifen, als das Interview schon längst vorbei ist und ich mich über die damalige Situation im Irak informiere.
Havin trifft ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt im Irak ein, der sich in der Presse später als «Arabischer Frühling» durchsetzen sollte. Im Nachbarstaat Syrien bahnt sich 2011 ein Bürgerkrieg an, im Irak selbst verüben Vorreiter des späteren IS zahlreiche Anschläge. Ein Selbstmordattentäter reisst in der Stadt Hilla 24 Polizisten in den Tod; wenige Monate später sterben bei einer Welle von Attentaten auf Mosul 70 Menschen. Die Stadt ist nur zwei Autostunden von Havins damaligem Aufenthaltsort entfernt.
Dort, im von Kurden kontrollierten Gebiet nahe der türkisch-syrischen Grenze, ist sie zwar relativ sicher, dennoch habe man auch dort Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen, sagt Havin, als ich mich Tage später bei ihr melde und wissen möchte, ob sie von den Spannungen etwas mitgekriegt habe. «Geplant war, in die Türkei zu flüchten, sollte die Situation eskalieren.» Viel mehr wisse sie allerdings nicht, nur, dass vermehrt Männer aus dem Dorf in die Berge zogen, um gegen den IS zu kämpfen. Von den Nachbarinnen hatte sie gehört, dass viele Ladenbesitzer ihre Geschäfte schlossen und ins Ausland flohen. «Da ich aber insgesamt nur dreimal das Haus verliess, habe ich davon kaum etwas mitgekriegt.»
Wie kann es sein, dass deine Eltern dich von der Schweiz in ein Krisengebiet schickten, Havin? Sie waren ja selbst aus der Region geflüchtet. War es Leichtsinn? Haben sie die Gefahr unterschätzt? Waren sie selbst vom Widerstand zu abgebrüht? Havin wirkt ratlos, weiss darauf keine Antwort, findet es nur «schrecklich», so nah an den Geschehnissen gewesen zu sein. Erst in der Schweiz sei ihr klar geworden, wie prekär die Lage im Irak gewesen war.
«Viele Eltern wollen in der Gemeinschaft besser dastehen», sagt Anu Sivaganesan, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. In den über 2’300 Beratungen ihrer Stelle hatte sie bereits mehrere Fälle wie Havins auf dem Tisch. Gleichzeitig herrsche in den betroffenen Familien oft ein Zwang zur Endogamie, so Sivaganesan weiter, also zur Bestimmung, dass nur innerhalb der eigenen ethnischen, religiösen oder Herkunftsgemeinschaft geheiratet werden darf. Will der Sohn oder die Tochter nicht mitmachen, wird das zum Problem. «Den Kindern wird vorgeworfen, egoistisch zu handeln und dem Ruf der Familie zu schaden; eigentlich handeln aber die Eltern egoistisch, indem sie das Wohlergehen ihres Kindes als weniger wichtig betrachten als das Wohl der Familie.»
«Den Kindern wird vorgeworfen, egoistisch zu handeln.»
Im Brautladen, in den Havin gebracht wird, hängen drei Kleider, die allesamt nach Schweiss riechen. Havin gefällt keines davon. Als sie sich für eines entscheidet, fällt ihr oberhalb der rechten Hüfte ein hellbrauner Fleck auf. Während der Zeremonie versucht sie ihn mit dem Ellbogen zu verdecken. Es gelingt ihr nicht wirklich. «Ich hatte mir immer vorgestellt, dass die Hochzeit der schönste Tag des Lebens ist. Doch dieser Traum war geplatzt.»
Sie und die Gäste sitzen auf weissen Plastikstühlen, die auf dem sandig-erdigen Boden wackeln. Später wird sie kaum an weissen Gartenstühlen vorbeigehen können, ohne sich an diesen Tag zu erinnern. Hinter sich hört sie Frauen tuscheln: «Hat die keine Mutter? Ich würde meine Tochter an ihrer Hochzeit niemals alleine lassen!» Ihr wird während der Zeremonie Goldschmuck im Wert von 2’500 Euro überbracht – ein für irakische Verhältnisse bescheidenes Geschenk. Trotzdem habe sie vom Gold nie etwas gesehen, sagt Havin fast heiter. «Sie hatten es für die Hochzeitsfeier bei einem Juwelier ausgeliehen.» Dann kommt die erste Nacht.
Wie in vielen Teilen der Welt herrscht auch im Irak die Meinung, dass eine Frau als Jungfrau in die Ehe gehen muss. Ein mit Blut beflecktes Laken soll am nächsten Morgen den Beweis erbringen. «Ich wollte nicht mit ihm schlafen», sagt Havin, «ausserdem hatte ich noch nie zuvor Geschlechtsverkehr gehabt. Ich hatte keine Ahnung, wie das ging und was da auf mich zukommen würde.»
«Ich war nur froh, war sein Geruch weg von mir.»
Nachts im Zimmer ist ihr Ehemann grob. Er fordert sie auf, die Beine zu spreizen, will das Ganze schnell hinter sich bringen. Havin wehrt sich, stösst ihn von sich weg. «Irgendwann war er beleidigt», erinnert sie sich. «Er hat sich umgedreht und ist eingeschlafen. Ich war nur froh, war sein Geruch weg von mir.»
Am nächsten Morgen taucht auch schon eine der Schwiegermütter auf, will das blutbefleckte Laken sehen. Havin kann nichts vorweisen. In der Nacht darauf wehrt Havin sich erneut. Die Schwiegermütter werden ungeduldig, die eine meint: «Wahrscheinlich hattest du schon mal was mit jemandem, das müssen wir deinem Vater sagen.»
In der dritten Nacht geht dann alles ganz schnell, «da hat er keine Rücksicht mehr genommen, hat es schnell hinter sich gebracht», sagt Havin. Für sie selbst sei es sehr schmerzhaft gewesen. «Ich stand unter Schock, habe das Blut auf dem Laken gesehen und einfach nur geweint.» Von da an sei es regelmässig so weitergegangen. «Zärtlichkeiten oder Küsse, wie ich es damals aus Filmen kannte, gab es nicht. Auch als er meine Brüste anfasste, war es grob und ohne Gefühl. Ich bin mir vorgekommen wie ein Objekt, als würde ich nur aus zwei Brüsten und dem Genitalbereich bestehen.»
«Ich bin mir vorgekommen, als würde ich nur aus Brüsten und dem Genitalbereich bestehen.»
Havin starrt jetzt zur Seite, sagt nichts mehr, wischt sich nur kurz über die Augen. Die Luft um uns herum ist schwer geworden, es atmet sich nicht leicht. Draussen dämmert es, im Büro ist es bereits dunkel. Ich sehe nur noch Havins Augen und die Umrisse ihres hellen Gesichts. Ihr schwarzes Haar ist mit dem Raum zu einer trüben Masse verschmolzen. Wir sitzen da und warten, beschliessen, dass dies ein Moment ist, der kein Licht verträgt. Ich frage Havin, ob sie eine Pause brauche oder das Gespräch abbrechen wolle, doch es ist ihr wichtig, ihre Geschichte zu erzählen.
Nach der dritten Nacht rufen die Schwiegereltern schliesslich den Vater in der Schweiz an: «Deine Tochter war ein Mädchen, wir gratulieren!» Havin steht noch immer unter Schock. Sie hat Schmerzen im Unterleib und eine Blasenentzündung.
«Deine Tochter war ein Mädchen, wir gratulieren!»
In dem orangeroten Haus, in dem Havin mit ihrem Mann und seiner Familie lebt, gibt es oft Streit. Die beiden Schwiegermütter, die jeweils ein Zimmer mit ihren Kindern bewohnen, zanken sich oft. Immer öfter wird auch Havin zum Streitthema. Da jede Schwiegermutter separat für sich und ihre Kinder kocht, ist Havin als Küchenhilfe begehrt. «War ich bei der einen Schwiegermutter, war die andere eingeschnappt und umgekehrt», erinnert sie sich.
Weil sie keine Lust auf das Gezanke hat, zieht Havin sich in ihr eigenes Zimmer zurück, lenkt sich mit Fernsehen ab oder hört Musik. Das macht ihre Schwiegermutter wütend. Sie ruft ihren Sohn an, beschwert sich: «Deine Frau sperrt sich hier ein. Sie hilft nicht!» Kurz darauf wird Havin ans Telefon geholt. Ihr Mann, der in jener Woche abwesend ist, droht: «Warte nur, was ich mir dir mache, wenn ich wieder zu Hause bin. Denkst du, du bist hier Königin oder was?»
«Ich hatte Gewalt ja nicht das erste Mal erlebt, ich kannte das ja schon von meinen Brüdern und vom Vater», sagt Havin, und die Worte klingen gleichgültig, wie eine lästige Wahrheit, mit der sie sich schon lange abgefunden hat. Als der Anruf von ihrem Mann kam, habe sie die Situation jedoch unterschätzt. «Ich dachte, wenn er mich schlägt, dann schlägt er mich halt – mein Vater hat mich ja auch geschlagen.» Doch hier kommt eine sexuelle Komponente hinzu: Ihr Mann schlägt sie und will später mit ihr schlafen. Auch als Havin Wochen später schwanger wird, hört die Gewalt nicht auf: «Ich weiss noch, wie er mir einmal mit einem Kabel auf den Bauch schlug.»
«Niemand fragte nach mir.
Nur die Krankenkasse schickte Mahnungen.»
Wie kann es sein, dass niemand dein Verschwinden bemerkte, Havin? Hattest du keine Freunde in der Schweiz? Keine Nachbarn oder Kollegen, denen deine Abwesenheit aufgefallen wäre? «Niemand fragte nach mir», sagt Havin. Sie sei von einem Tag auf den anderen verschwunden, habe sich nicht mal von ihrem Wohnort abgemeldet. Da sie nicht arbeitete, kein Arbeitslosengeld und keine Sozialhilfe bezog, sei ihr Verschwinden bei den Behörden nicht aufgefallen. Nur die Krankenkasse habe regelmässig Mahnungen und Betreibungen geschickt, weil niemand die Rechnungen zahlte.
Dass Havins Verschwinden nicht ganz so unbemerkt geblieben war, erfahre ich von einer ehemaligen Klassenkameradin ihrer älteren Schwester, die mich überhaupt erst auf Havins Geschichte aufmerksam gemacht hatte: «Wir alle wussten, dass Havins Vater streng war und dass es regelmässig zu Gewalt in der Familie kam», erzählt diese. So sei Havins Schwester einmal mit einem Verband um den Arm zur Schule gekommen. «Sie behauptete, von der Treppe gefallen zu sein, doch wir haben vermutet, dass das nicht stimmte.»
«Auch wenn wir es mit Sicherheit gewusst hätten – was hätten wir tun können?»
Allerdings habe das damals auch niemanden so wirklich schockiert; viele ihrer damaligen Mitschüler seien zu Hause von den Eltern geschlagen worden. Auch später, als Havin verschwand, wurde in der Nachbarschaft darüber geredet: «Es ging das Gerücht um, ihr Vater habe sie in den Irak gebracht, um sie zu verheiraten.» Man müsse das Ganze allerdings auch nüchtern betrachten, so die Bekannte weiter, denn wer hätte schon mit Sicherheit sagen können, ob an dem Gerede was dran war? «Und auch wenn wir es mit Sicherheit gewusst hätten – was hätten wir schon tun können?»
Bist du von Zwangsheirat betroffen? Kennst du jemanden, der davon betroffen oder bedroht ist? Hilfe gibt es bei der Fachstelle Zwangsheirat oder unter der Gratis-Helpline 0800 800 007.
Dass im Umfeld niemand reagiert habe, sei nicht überraschend, sagt Anu Sivaganesan von der Fachstelle Zwangsheirat. «Es ist tragisch, wenn in einer konkreten Situation niemand hilft, doch noch immer wissen viele nicht, dass es in der Schweiz Zwangsheiraten gibt.» Zum anderen seien Menschen aus dem Umfeld oft überfordert mit der Situation; sie wüssten nicht, wie helfen. Von Alleingängen und Konfrontationen mit der Familie rät Sivaganesan ab, stattdessen solle man eine Fachstelle aufsuchen.
Das ganze Interview mit Anu Sivaganesan gibt es hier.
Acht Monate nach der Hochzeit erfährt Havin, dass ihre Eltern planen, in den Irak zu kommen – ihr Bruder ist auf der Suche nach einer Frau. Sie kann auch das erste Mal seit ihrer Ausreise mit ihrer Mutter telefonieren. «Ich habe am Telefon nur geweint», erinnert sich Havin, «habe meine Mutter angefleht, mich aus diesem Loch herauszuholen.» Diese ist über den verbrannten Pass informiert und versucht ihre Tochter zu beruhigen. Bevor sie auflegt, sagt sie noch: «Ich habe eine Lösung, doch sag niemandem Bescheid.»
Havin zählt die Tage bis zur Rückkehr ihrer Eltern. Sie verlässt sich auf das Versprechen ihrer Mutter und freut sich, ihren Bruder wiederzusehen. Als ihre Familie im Irak eintrifft, ist Havin von ihren Gefühlen überwältigt: Hoffnung, Freude, Wut und Enttäuschung lassen sie innerlich fast zerspringen. «Ich habe meine Eltern gesehen, meinen Bruder, habe das erste Mal seit Monaten wieder Berndeutsch gesprochen – das alles hat sich so komisch und unecht angefühlt, wie wenn du monatelang durstest und plötzlich bringt dir jemand ein Getränk.» Ihre Mutter hat den Pass von Havins Schwester dabei; damit will sie die Tochter aus dem Land schaffen.
«Wenn wir sie zurückholen, wird sie sich scheiden lassen.»
Havin zweifelt, dass der Plan aufgehen wird. Im Pass ist kein Einreisestempel, ausserdem findet sie, dass sie der Schwester nicht ähnlich sieht. «Meine Mutter meinte nur, wir würden das schon schaffen, sie müsse nur meinen Vater überzeugen.» Doch dieser stellt sich quer: «Wenn wir sie zurückholen, wird sie sich sofort scheiden lassen.» Die beiden Frauen können ihn schliesslich überreden, Havin samt Ehemann in die Schweiz zu holen. Nach viel Überzeugungskunst lassen sich auch Havins Mann und seine Familie auf den Vorschlag ein – unter der Bedingung, dass monatlich 800 Dollar in den Irak fliessen. Wenig später packt Havin ihre Sachen. Vor lauter Aufregung bekommt sie kaum mit, dass ihr Bruder die Cousine geheiratet hat.
Am Tag der Abreise ist Havin nervös. Sie versucht sich so zu schminken, dass sie der Schwester auf dem Passfoto ähnlich sieht. Laut Plan soll sie gemeinsam mit ihren Eltern im Auto in die Schweiz zurückfahren. Eine Reise von mindestens vier Tagen. Ihr Mann soll währenddessen mit Schleppern bis nach Griechenland gelangen. Dort will man sich treffen und gemeinsam mit der Autofähre über Italien in die Schweiz einreisen. Havin ist zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger. Ihre Niere schmerzt seit Wochen. Eine ärztliche Untersuchung beim Gynäkologen hat sie bisher noch nicht gehabt. Dennoch kann sie es kaum erwarten, die lange Reise anzutreten.
In Griechenland will man sich treffen und über Italien in die Schweiz fahren.
An der türkischen Grenze fragen die Zollwärter nach dem Einreisestempel im Pass. Der Vater meint, dieser sei wohl vergessen gegangen. Havin sitzt auf dem Rücksitz und versucht gleichgültig aus dem Fenster zu sehen, doch ihr Puls rast, während die Männer abwechselnd auf sie und das Foto ihrer Schwester starren. Dann winken sie die Familie über die Grenze.
In Griechenland stossen sie auf Havins Mann. Dort wartet allerdings schon die nächste Herausforderung auf sie: Es ist November 2011 und Griechenland befindet sich wegen der Schuldenkrise im Ausnahmezustand. Die EU hat soeben die Hilfskredite für das Land gestoppt, der griechische Ministerpräsident ist zurückgetreten, in Athen ist eine Übergangsregierung an der Macht. Gegen deren drastische Sparmassnahmen gehen Zehntausende auf die Strasse. Streiks und gewaltsame Demonstrationen legen das ganze Land lahm.
«Ich dachte, vielleicht will Gott einfach nicht, dass ich in der Schweiz ankomme.»
Mitten im Chaos wartet Havin am Hafen von Igoumenitsa ungeduldig darauf, dass das Schiffspersonal seinen Streik beendet und sie mit der Fähre über die Adria nach Italien bringt. «Es war katastrophal», erinnert sie sich. «Ich war schwanger, trotzdem schliefen wir und viele andere drei Nächte lang im Auto oder beim Ticketstand auf dem Boden. Ich dachte, vielleicht will Gott einfach nicht, dass ich in der Schweiz ankomme.» Von den 100 Dollar, die sie bei sich hat, möchte sie etwas zu essen kaufen. Doch keine Bank in Griechenland ist zu diesem Zeitpunkt bereit, Dollar in Euro zu wechseln. «Wir haben uns von Brot und Tomaten ernährt», erinnert sie sich.
Das lange Warten zerrt auch an den Nerven ihres Mannes. Unruhig sitzt er im Auto, spielt nervös mit dem Zündschlüssel, lässt den Motor anlaufen, schaltet ihn wieder aus. Havins Vater fordert ihn auf, sich unauffällig zu verhalten, er sei schliesslich illegal hier. «Das hat ihn irgendwie gekränkt», sagt Havin. «Er wurde wütend und meinte, mein Vater könne nicht so mit ihm sprechen, er würde sich jetzt der Polizei stellen und verlangen, in den Irak zurückgeschickt zu werden. Dann war er weg.» Ich gebe mir Mühe, mein Staunen zu verbergen, doch es gelingt mir nicht wirklich. Ein müdes Lächeln huscht über Havins Gesicht. Sie schüttelt ungläubig den Kopf: «Wir haben ganz Igoumenitsa nach ihm abgesucht, doch er blieb verschwunden. Schliesslich kehrten wir ohne ihn in die Schweiz zurück.»
Teil 3
Was einen fast erleichtert aufatmen lässt, weil es sich wie das Aufwachen aus einem üblen Traum anfühlt, ist keines. Ihr Mann meldet sich kurz darauf aus Thessaloniki, wo er mit einer Gruppe Landsmännern feststeckt. Die griechische Regierung ist derart überfordert, dass keine Ausweisungen stattfinden können. Er möchte, dass Havin zurückkommt und mit ihm in den Irak reist. Diese weigert sich. Es kommen auch Anrufe aus dem Irak – die Familie ihres Mannes beschuldigt Havin und ihre Mutter, alles geplant und sie hereingelegt zu haben. Auch von Seiten ihrer Brüder gerät Havin zunehmend unter Druck: «Wie kannst du hier so ruhig rumsitzen, während dein Mann vielleicht irgendwo im Knast steckt?»
Es ist schliesslich Havins Bruder, der dem Vater 2’500 Franken in die Hand drückt – «Holt ihren Mann mit einem Schlepper hierher!» Wussten deine Brüder von den Misshandlungen, Havin? Hast du ihnen davon erzählt? «Nein, ich habe mich geschämt, darüber zu sprechen», sagt sie. Havins Vater nimmt zwar das Geld, beschliesst jedoch insgeheim, den Schwiegersohn selbst in die Schweiz zu holen. Dieser ist noch immer eingeschnappt und verlangt, dass Havin mitkommt. Der Vater ist dagegen, doch Havin selbst stimmt trotz ihres schlechten Gesundheitszustands und der Schwangerschaft zu.
«Dieser Schritt, mich von zu Hause loszulösen, mit der Aussenwelt in Kontakt zu treten, war so schwierig.»
«Wenn ich daran zurückdenke, kann ich nur den Kopf schütteln – ich war so dumm», sagt sie heute. Es sei unverständlich, weshalb sie sich nicht gewehrt habe, doch die Angst vor dem Alleinsein sei zu stark gewesen. «Hätte ich damals meinen eigenen Kopf gehabt, wie jetzt – ich hätte ihn in Griechenland einfach stehenlassen. Doch damals ging das nicht. Dieser Schritt, mich von zu Hause loszulösen, mit der Aussenwelt in Kontakt zu treten, war so schwierig.» Havin ist überzeugt, dass das Handeln ihrer Familie ausschlaggebend dafür war: «Niemand kam zu mir und sagte: ‹Ich helfe dir, jag diesen Mann zum Teufel!›» Stattdessen habe man ihm die Opferrolle zugewiesen: «Gib ihm Zeit. Er wird sich noch an alles gewöhnen. Das ist alles noch ganz neu für ihn.» Dieses Denken habe sie übernommen.
In der Schweiz erhält ihr Mann via Familiennachzug eine Aufenthaltsbewilligung. Nachdem die beiden abwechselnd bei Havins Eltern und den Geschwistern gewohnt haben, können sie eine eigene Wohnung beziehen. Doch es kommt immer wieder zum Streit. «Ich erinnere mich, wie meine Schwägerin einmal zum Coiffeur ging – ich wollte mit. Doch er war dagegen und meinte, nur Schlampen würden sich beim Coiffeur die Haare schneiden. Es artete dermassen aus, dass ich nach einer Schere griff und mir das Haar abschnitt.» Auch an die Geburt ihres Sohnes hat sie keine schönen Erinnerungen. Sie habe sich leer gefühlt, habe nichts empfunden. «Es war nicht wie bei den anderen zwei Kindern, mit kuscheln und auf den Arm nehmen. Ich wusste einfach, ich habe jetzt ein Kind, darauf muss ich aufpassen.»
In der neuen Wohnung wird die Gewalt ihres Mannes für Havin zur Tagesordnung. Die Nachbarn schalten sich ein, es folgt ein Anruf der KESB. Die Mitarbeiterin will wissen, ob Havin Gewalt erlebe. «Sicher nicht, mein Mann schlägt mich nicht!» Sie habe nicht auch noch Probleme mit den Behörden gewollt, erklärt sie ihre Reaktion heute. Havin und ihr Mann ziehen um, doch in der neuen Wohnung wird alles nur noch schlimmer und die Polizei schaltet sich ein. Das ist der Moment, in dem Havin beginnt zu reden. Sie erzählt von den Misshandlungen, verbringt mit ihrem sechsmonatigen Sohn eine Woche im Frauenhaus. Ihr Mann und die Eltern versprechen Besserung, doch diese hält nicht an.
«Sicher nicht, mein Mann schlägt mich nicht!»
«Das wurde irgendwie alles normal für mich», sagt Havin. «Ich hatte ein Kind. Ich erlebte Gewalt. Ich bin einfach damit umgegangen.» Nach Monaten kommt ihr Mann schliesslich auf sie zu, möchte mit ihr reden. Es sei das erste Mal gewesen, dass die beiden eine richtige Unterhaltung geführt hätten, erinnert sich Havin. «Er wollte wissen, woran es lag, dass ich nicht mit ihm schlief. Ich konnte ihm klarmachen, dass ich ihn nie geliebt hatte, doch nicht wollte, dass mein Sohn ohne Vater aufwuchs. Anscheinend hat das etwas in ihm ausgelöst, denn er meinte: ‹Wenn das so ist, sollten wir uns scheiden lassen.› Dazu müssten wir zurück in den Irak.»
Die Ankündigung der Scheidung habe sie zunächst kalt erwischt, sagt Havin, doch schon bald löst sich die Anspannung und ein warmes Gefühl der Erleichterung breitet sich in ihr aus. Ihr Mann hat die Scheidung gewollt. Niemand kann ihr vorwerfen, eine Ehe beendet zu haben. Sie stellt sich ein Leben ohne ihn vor, nur sie und ihr Sohn, und die Furcht vor dem Alleinsein scheint beinahe überwunden. Ihr Mann legt die Hand auf den Kopf des Kindes, schwört, dass sie im Irak die Scheidung vollziehen würden. «Also habe ich die Tickets gebucht», sagt Havin.
«Eine Mitarbeiterin des Migrationsamtes meint noch heute, das sei ein Fehler ihrer Behörde gewesen.»
Hättet ihr euch nicht in der Schweiz scheiden lassen können, Havin? Haben keine Alarmglocken bei dir geläutet? «In der Schweiz war unsere Ehe noch nicht mal anerkannt», erklärt Havin. «Er hat via Familiennachzug seinen Ausweis bekommen, ohne offizielle Heirat oder Kindesanerkennung. Eine Mitarbeiterin des Migrationsamts in Bern meint noch heute, das sei ein Fehler ihrer Behörde gewesen.» Dennoch habe sie sich verheiratet gefühlt; es sei ihr wichtig gewesen, die Scheidung zu vollziehen, auch offiziell einen Schlussstrich zu ziehen. «Ich wollte nicht, dass man irgendwann sagt: ‹Die hat einen Mann im Irak und einen Mann in der Schweiz.›»
Havin fliegt mit Mann und Sohn via Jordanien nach Erbil, einer Stadt im von Kurden dominierten Teil des Iraks. Kurz vor der Landung bemerkt sie, dass ihr Mann einen Ballen zusammengerollter Geldscheine in der Jackentasche trägt. Es ist das Geld, das sie ihm fürs Überweisen der Miete gegeben hat. «Hast du vergessen, die Miete zu bezahlen?», fragt sie ihn, und noch während sie zu Ende spricht, ahnt sie, wie naiv die Frage klingt. «Das Geld brauche ich, um meinen Sohn grosszuziehen. Oder hast du ernsthaft geglaubt, dass ich ihn mit dir zurückfliegen lasse?», lautet seine Antwort.
«In diesem Moment wollte ich einfach nur schreien», sagt Havin, «doch es waren fast ausschliesslich Männer im Flugzeug – die wären sowieso alle auf seiner Seite gewesen.» Starr vor Angst lehnt sie sich zurück, gräbt ihren Hinterkopf in den Sessel und schliesst die Augen. Sie fühlt, wie ihre Füsse leicht werden und sich die Welt um sie herum zu drehen beginnt. «Den Rest des Fluges betete ich nur, dass der Flieger abstürzt», sagt sie.
«Ich wollte einfach nur schreien.»
Im Irak angekommen, wagt Havin einen letzten Hilferuf. Sie bittet den Taxifahrer, ihre Eltern in der Schweiz zu kontaktieren. Doch ihr Mann geht dazwischen – das sei nicht nötig. «Wir fuhren schweigend zu seinem Dorf», erinnert Havin sich, «der Druck in meinem Magen war so unheimlich gross, dass ich fast erbrochen hätte.»
Beim orangerosa Haus der Familie warten schon die Schwiegermutter und die Schwägerin an der Tür. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, führen sie Havins Sohn ins Haus. Sie selbst wird in ein Zimmer gebracht und verprügelt – «für all die Zeit in der Schweiz, in der ich ihn hätte leiden lassen», erinnert sich Havin an die Worte. «Hier hätte ich keine Familie oder Behörde, mit der ich mich in meiner Sprache unterhalten könne.»
«Hier hast du keine Behörde, in der du dich in deiner Sprache unterhalten kannst.»
Am Abend erscheint Havins Schwiegervater. Er stellt sie vor die Wahl: «Entweder du gehst, lässt aber deinen Sohn hier – er ist unser Fleisch und Blut. Oder aber du bleibst, und ich sorge dafür, dass ihr zusammenleben könnt.» «Natürlich antwortete ich, dass ich hierbleiben würde», sagt Havin, in Gedanken sei sie jedoch bereits auf der Flucht gewesen. Am Tag darauf ruft sie heimlich die Sozialarbeiterin in der Schweiz an. Doch diese meint, solange Havin sich im Irak aufhalte, seien ihr die Hände gebunden. Havin kontaktiert ihren Cousin und bittet ihn, sie abzuholen. «Es war abgemacht, dass ich bis zur Scheidung bei meiner Tante bleibe», erklärt sie. Doch die Schwägerin bekommt das Telefonat mit. Als Havins Mann nach Hause kommt, wird sie derart verprügelt, dass sie kaum noch atmen kann. Ihr wird weiss vor Augen.
Havins Blick ist leer, als sie von der Szene berichtet. «Seine Mutter kam nur kurz ins Zimmer, führte meinen Sohn hinaus und schloss hinter sich die Tür. Sie haben alle mitbekommen, wie er auf mich einschlug, und haben nichts unternommen.» Den Rest des Tages liegt Havin regungslos im Bett ihres Zimmers, öffnet und schliesst nur immer wieder die Augen. Um fünf Uhr morgens steht sie schliesslich auf und schleicht ins Zimmer der Schwiegermutter, wo ihr Sohn schläft. Sie presst dem Buben ihre Hand auf den Mund und hastet mit ihm hinaus auf die Strasse. «Ich hielt Ausschau nach einem Auto, in dem eine Frau sass, doch da kam keins.»
Wenige Augenblicke später hört sie Schritte hinter sich. Die Schwiegermutter hatte ihren Fluchtversuch bemerkt und ihren Sohn geweckt. Als Havin sich umdreht, blickt sie in das wutverzerrte Gesicht ihres Mannes, der schreiend auf sie zurennt. Sie rennt mit ihrem Sohn im Arm los, doch plötzlich spürt sie, wie ihr Kopf ruckartig nach hinten gerissen wird. Ihr Mann hat sie an den Haaren erwischt und zerrt sie daran zum Haus zurück. Die Nachbarschaft ist wach, die ganze Familie auf der Strasse. «Plötzlich war ich von all diesen Leuten umgeben, die mich beschimpften und ‹Hure› nannten», sagt Havin.
Zurück im Haus fragt der Schwiegervater wütend, was das solle. «Du hättest entführt werden können, dann wären wir an allem schuld gewesen!» Havin zeigt auf die Verletzungen vom Vortag. Ihr Körper ist mit blauen Flecken übersät, an der linken Hand spürt sie kaum ihre Finger. «Nicht mal ein Esel hält es mit deinem Sohn aus», sagt sie zum Schwiegervater und fordert: «Gebt mir mein Kind, ich will einfach nur gehen!» «Das Kind bleibt hier», lautet die Antwort. Wenig später sitzt Havin im Auto auf dem Weg zu ihrer Tante. Ihren Sohn hat sie nicht bei sich.
«Gebt mir mein Kind, ich will einfach nur gehen!»
«Ich kann mich noch genau an diese Fahrt erinnern», sagt sie. «Sein Bruder fuhr, sein Vater sass auf dem Beifahrersitz, mein Mann neben mir auf dem Rücksitz. Er hatte mein Handy in der Hand und scrollte durch die Bilder meines Sohnes. Als wollte er mich verhöhnen, meinte er: ‹So, das hast du nun davon. Deinen Sohn wirst du nie mehr wiedersehen!› Ich habe ihm nur den Tod gewünscht.»
Bei der Tante angekommen, bringt der Schwiegervater Havin ins Haus, gibt ihr die Schuld am Scheitern der Ehe. Havin erinnert sich: «Meine Tasche war noch samt Handy im Auto, wo mein Mann sass. Als ich es zurückbekam, merkte ich, dass er alle Fotos von meinem Sohn gelöscht hatte.»
Die Tante ruft Havins Eltern in der Schweiz an, erzählt, was vorgefallen ist. Ihr Vater sagt nichts dazu. Erst Wochen später erfährt Havin, dass ihre Eltern von der geplanten Entführung gewusst hatten. Ihre Mutter erzählt ihr, wie ihr Mann bei einem Telefongespräch mit dem Schwiegervater sagte: «Diese Ungezogene wagt es tatsächlich, sich scheiden zu lassen! Sie gehört euch, macht mit ihr, was ihr wollt!» Havin macht eine Pause und erklärt entschuldigend, dass sich die Worte auf Deutsch ganz komisch anhören würden. «Unter einer ‹Ungezogenen› verstand mein Vater eine Frau, die sich widersetzte und ihre Wurzeln nicht mehr kannte, eine, die keinen Wert auf Traditionen legte.» Auf Deutsch habe sie keinen Wortschatz dafür, sagt Havin, auf Kurdisch höre sich das viel realer an.
«Ich hatte nicht vor, mein Kind im Irak zu lassen», fährt Havin fort. Sie hat die Geburtsurkunde ihres Sohnes dabei, in der ihr Mann nicht als Vater eingetragen ist. Damit will sie zu einer internationalen Menschenrechtsorganisation und mit deren Hilfe ihr Kind zurückholen. «Ich bat meine Tante, mich dorthin zu fahren, doch meine Mutter sagte ihr per Telefon, sie solle das nicht tun.» Havin bleibt nichts anderes übrig, als tatenlos auf ihren Rückflug zu warten. «Ich habe einfach mein Kind dort gelassen und bin hierher zurück», sagt sie und wischt sich über die Augen. Es klingt wie ein hartnäckiger Vorwurf, der sie noch immer begleitet. Auch die Scheidung sei bis heute nicht vollzogen worden.
Teil 4
Zurück in der Schweiz holen Havins Eltern sie vom Flughafen ab. «Sie sahen aus, als hätten sie Mitleid mit mir», sagt Havin. Dennoch wird über die Geschehnisse der vergangenen Monate kaum geredet. Havins Familie kehrt die Angelegenheit sorgfältig unter den Teppich, mitsamt dem Kind, das sich noch im Irak befindet, Havins Kind. Unterdessen meldet sich ihr Ex-Mann mehrere Male per E‑Mail, behauptet, er habe im Irak eine neue Mutter für den gemeinsamen Sohn gefunden. Havin bittet ihn, wenigstens zum Impftermin des Buben zurück in die Schweiz zu kommen. Nichts geschieht.
«Ich wollte nichts mehr fühlen oder sehen.»
Es folgen Monate, in denen Havin in ein dunkles Loch fällt. Sie weint viel, findet keinen Schlaf, durchlebt die Misshandlungen der vergangenen Monate immer wieder in ihrem Kopf. Währenddessen zieht der Alltag dumpf und schwammig an ihr vorbei, lässt sie kraftlos hinter sich zurück. «Ich wollte nichts mehr fühlen oder sehen», sagt Havin. In jener Zeit habe sie auch angefangen zu rauchen, sich überlegt, Alkohol und Drogen auszuprobieren. «Ich konnte einfach keine Kinder mehr sehen, weil mich jedes einzelne an meinen Sohn erinnerte.» Von den Schwestern kommen Vorwürfe: «Wie hältst du das aus? Für mein Kind würde ich sogar in der Hölle leben.»
Dann, der Winter ist längst eingebrochen, eine überraschende Nachricht von ihrem Vater: Ihr Ex-Mann habe sich gemeldet, er wolle zurück in die Schweiz – «Aber ihr müsst versuchen, wieder zusammenzuleben», lautet die altbekannte Bedingung. Havin zögert keine Sekunde, stimmt zu. Dann erstattet sie bei der Polizei Anzeige wegen häuslicher Gewalt und Kindesentführung.
«Ihr müsst versuchen, wieder zusammenzuleben»
Es ist ein kalter Freitagabend, als ihr Ex-Mann und Sohn am Münchner Flughafen landen. Havin und ihr Vater warten bereits im trostlosen Licht der Empfangshalle auf sie. «Da Freitag war, sagte man mir, ich müsse bis Montagmorgen auf den Polizeieinsatz warten», erklärt Havin, und in ihren Augen blitzt ein Rest Fassungslosigkeit auf, den sie bei dieser Aussage gespürt haben muss.
Als sie ihren Sohn in der Menge entdeckt, versetzt ihr sein Anblick einen Stich ins Herz. Das schwarze Haar klebt nass an seinem Kopf. In der viel zu kleinen Jacke und den altertümlichen Schuhen sieht er verloren aus, als wäre er nur durch einen Irrtum an diesem kalten Ort gelandet. Havin möchte ihn umarmen, ihn an sich drücken, doch er schreckt vor ihr zurück, fängt an zu weinen und klammert sich ängstlich an das Bein seines Vaters. «Ich habe mich in diesem Moment so wertlos gefühlt», sagt Havin, «mein eigener Sohn erkannte mich nicht mehr, hatte sich völlig von mir entfremdet.» Auch später, als sie in der Wohnung mit ihm spielen will, weint der Junge. «Das hat meine Wut nur noch wachsen lassen», sagt Havin und wirkt elektrisiert, als würde sie den Moment nochmals erleben.
Um bis zum Einschreiten der Polizei keine Komplikationen zu haben, verbringt sie das Wochenende damit, ihrem Ex-Mann und den Eltern etwas vorzumachen. Sie beteuert, der Ehe eine Chance geben zu wollen, schaut dabei insgeheim auf die Uhr und zählt die Minuten bis zum Anbruch des Montagmorgens, denn um sechs hat die Polizei versprochen, vor der Tür zu stehen.
Als ihr Mann am Sonntagabend anfängt, sie beim Fernsehen am Knie zu berühren, kann Havin nicht mehr. Die angestaute Wut lässt ihre Fassade wie Geröll auf die Erde donnern. «Hast du ernsthaft das Gefühl, ich würde mein Leben mit dir verbringen?», faucht sie wütend. Dann fügt sie hinzu: «Morgen kommt die Polizei. Du kannst mich umbringen, doch alle wissen Bescheid.»
«Morgen kommt die Polizei.»
«Ich habe dann den Fernseher ausgeschaltet, bin zu meinem Sohn ins Zimmer und habe die Tür hinter uns abgeschlossen», sagt Havin. Ihr Mann sei einfach auf dem Sofa sitzengeblieben. «Er dachte bestimmt, die blufft nur.»
Am Montag um Punkt sechs klingelt schliesslich eine Sondereinheit von sechs Polizisten an Havins Wohnungstür. Auch der Chef des Jugendamts ist da. Die Beamten überraschen Havins Mann im Schlaf, der sich bei der Festnahme wehrt und anfängt zu schreien. Auch Havins Sohn schreit, lässt sich nicht beruhigen. «Als sie meinen Ex-Mann schliesslich rausgebracht hatten, war mein Sohn plötzlich ganz ruhig», erinnert Havin sich. «Er ist einfach in sich zusammengesackt und in meinen Armen eingeschlafen.»
Havins Mann bleibt 24 Stunden in Untersuchungshaft. Der Chef des Jugendamts will Havins Sohn mitnehmen, ihn zu dessen Sicherheit fremdplatzieren. Havin selbst soll zu ihren Eltern zurück. «Ich habe ihm gesagt, das gehe nur über meine Leiche», erzählt sie. «Seit Monaten versuche ich von den Schweizer Behörden Hilfe zu erhalten, und jetzt, wo mein Sohn endlich wieder bei mir ist, wollen Sie ihn mir wegnehmen?» Sie erklärt den Polizisten auch, dass sie bei ihren Eltern nicht sicher sei. «Das ist der erste Ort, an dem man mich ausliefern wird.»
«Irgendwann gelangt man zum Knochen, und dann geht es nicht mehr weiter.»
Und wie von Havin vorausgesagt, wollen die Eltern sie am nächsten Tag dazu bewegen, zu ihrem Mann zurückzukehren. «Aber da war endgültig Schluss», sagt Havin. «Man schneidet und schneidet ins Fleisch, doch irgendwann gelangt man zum Knochen, und dann geht es nicht mehr weiter.» Havin ruft die Schwiegereltern im Irak an: «Euer Sohn sitzt auf der Strasse und ich bin nicht mehr seine Frau.» Der Schwiegervater besteht auf die Scheidung im Irak, «da musste ich am Telefon lachen», sagt Havin.
«Ich bin nicht mehr seine Frau.»
Die nächsten sechs Monate verbringt sie mit ihrem Sohn im Frauenhaus – und ist das erste Mal seit Langem glücklich. «Mit den Frauen dort hatte ich es gut. Wir mussten alle mit wenig Geld auskommen, haben gemeinsam gekocht und Dinge unternommen. Es war wirklich sehr schön.» Es gelingt ihr auch, wieder Nähe zu ihrem Sohn aufzubauen. Und Havin nützt die Zeit, sich mit dem Schweizer Rechtssystem auseinanderzusetzen – was ist ein Beistand? Welche Rechte hat sie? Als sie aus dem Frauenhaus kommt, fühlt sie sich gestärkt. «Ich hatte endlich wieder Kraft, klare Gedanken zu fassen und für mich selbst zu denken.»
Ihre Liebe zur französischen Sprache zieht Havin nach Freiburg, wo sie sich eine eigene Wohnung sucht. Die Adresse hält sie geheim. Wenig später fängt sie eine Ausbildung an. Abgesehen von den betreuten Besuchsterminen, die die Behörden ihrem Ex-Mann einmal monatlich gewähren, hat Havin keinen Kontakt zu ihm.
Doch die Ruhe hält nicht lange an. Während Havins wöchentlichem Ausbildungskurs passt ihre Mutter auf den Enkel auf. Als Havin eines Abends ihren Sohn abholen will, sieht sie den Ex-Mann neben Mutter und Sohn auf dem Sofa sitzen. «Ich war ausser mir vor Wut», erinnert Havin sich. Sie wirft ihrer Mutter vor, sie dem Terror ihres Ex-Mannes ausgeliefert zu haben – und behält recht mit ihrer Befürchtung. Denn von da an klingelt es regelmässig an Havins Tür, spitze Kieselsteine prallen an ihrem Fenster ab. Havin glaubt, dass ihr Ex-Mann ihr an jenem Abend auf dem Heimweg gefolgt ist, und so ihren neuen Wohnort ausfindig machen konnte. Die Polizei kann ihr nicht helfen. Es brauche einen Distanzbericht vom Gericht, heisst es.
«Er hätte schon längst abgeschoben werden sollen.»
«Er hätte schon längst abgeschoben werden sollen», erklärt Havin niedergeschlagen, «doch der Beistand meines Sohnes konnte erstreiten, dass die Heirat im Irak nachträglich anerkannt wurde – dadurch wurde er unterhaltspflichtig.» Sie selbst sei gegen die Anerkennung der Heirat gewesen, «ich wollte ihn ja nie heiraten, und ich wollte nicht, dass er hierbleibt».
Havin traut sich wegen der Belästigungen kaum noch aus dem Haus und lenkt sich abends, wenn ihr Sohn im Bett ist, beim Spielen auf der PlayStation ab. «Dort konnte ich übers Mikrofon mit wildfremden Leuten reden» sagt sie fast fröhlich, «da war niemand, der mir Vorwürfe machte, niemand, der sagte: ‹Für meinen Sohn würde ich in der Hölle leben.›» So lernt sie auch ihren künftigen Mann kennen. «Ich schoss ihm bei GTA 5 in den Rücken», erinnert sich Havin lachend, und etwas verlegen fügt sie hinzu: «Als er erfuhr, dass hinter meiner Spielfigur eine Frau steckte, war er ziemlich beeindruckt.»
«Ich schoss ihm in den Rücken.»
Sie und der junge Mann aus Berlin kommen sich näher, tauschen Fotos aus, sprechen stundenlang übers Mikrofon miteinander. Er schafft es, Havin wieder zum Lachen zu bringen. Von ihrem Sohn erzählt sie ihm erst später. «Ich dachte, er rennt davon, wenn er von meinem Kind erfährt», sagt sie, doch er habe alles gut aufgenommen. Ihre ganze Geschichte erfährt er erst, als er via Mikrofon das Sturmklingeln ihres Ex-Mannes an der Tür hört.
Havin beschliesst, mit ihrem Sohn nach Berlin zu reisen, den ihr so vertrauten Unbekannten zu treffen. Da er bei Havins Ankunft arbeiten muss, fährt seine Schwester die Gäste zu sich nach Hause. «Wir waren müde von der langen Zugfahrt», sagt Havin, «also legte ich meinen Sohn ins Bett und bin dabei selbst eingenickt.» Das Nächste, woran sie sich erinnern kann, ist ein grosser, dunkelhaariger Mann, der am Türrahmen steht und sie verlegen angrinst. «Seine Stimme klang wie am Telefon und er sah aus wie auf den Fotos», sagt Havin lächelnd. Mit ihm sei alles ganz anders gewesen, ein völlig neues Gefühl. «Er war so lustig und lieb, nahm mir die kleinste Arbeit ab.» Auch seine Eltern hätten sie herzlich empfangen, «sie sprachen sogar einige Brocken Kurdisch, obwohl sie Türken sind».
«Mit ihm war alles anders, ein völlig neues Gefühl.»
Doch der glückliche Moment, den Havin geniesst, wird schon bald gestört. Ihre Eltern und ihr Ex-Mann haben noch am selben Tag ihre Abwesenheit bemerkt und belästigen sie mit Anrufen. Als sie schliesslich erfahren, dass Havin sich bei einem Mann im Ausland aufhält – noch dazu einem Türken –, drohen sie ihr mit dem Tod. «Sie kamen auch mit absurden Theorien, dass ich religiös betrachtet erst nach sieben Jahren das Recht hätte, mich scheiden zu lassen. Die Mutter meines Freundes, die in Berlin in einer Moschee arbeitet, hat mir dann erklärt, dass das alles Bullshit sei.»
Havins neuer Freund hat Angst um sie, und so beschliesst Havin, mit ihrem Sohn vorerst in Berlin zu bleiben. «Ich hatte keine Lust, alles noch einmal durchzustehen: wieder ins Frauenhaus. Wieder eine Wohnung suchen. Wieder Angst haben, dass er mich aufspürt und belästigt. Aus dem geplanten Wochenende wird schliesslich ein Jahr. Erst als Havin mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, kehrt sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite in die Schweiz zurück. Vor wenigen Monaten hat sie hier ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Zu ihrem Ex-Mann und ihrer Familie hat sie heute keinen Kontakt.
«Erst da habe ich losgelassen.»
Was möchtest du Betroffenen in einer ähnlichen Situation mitteilen, Havin? «Sucht euch so schnell wie möglich Hilfe», sprudelt es aus ihr heraus, denn Warten mache die Sache nur noch schlimmer. Dann erklärt sie, dass es viele Frauen gebe, die ihre Familie nicht gegen die Aussenwelt tauschen wollten, obwohl diese ihnen schade. Dabei klingt «Aussenwelt» wie ein fest definierter Begriff, ein Ort, über den sie schon viel gehört und nachgedacht hat.
«Oft muss etwas sehr Schlimmes passieren, bis man sich von solchen Gedanken lösen kann», fährt Havin fort. Bei ihr sei dies nach der Entführung ihres Sohnes geschehen, «als selbst im dunkelsten Loch niemand für mich da war». Ihre Mutter sei kurz nach der Entführung sogar in den Irak gereist, um an einer Hochzeit mitzufeiern. Das habe sie verletzt, sagt Havin, erst da habe sie losgelassen.
«Viele Frauen haben Angst, keinen geeigneten Partner zu finden.»
Einen weiteren Grund dafür, dass viele Frauen sich derart unter Druck setzen lassen, führt sie auf die Angst zurück, allein auf der Strasse zu enden. «Du wächst ein Leben lang mit der Idealvorstellung einer eigenen Familie mit Kindern auf», erklärt sie. «Doch wenn du einen anderen Weg einschlägst, von zu Hause ausziehst oder in einer WG lebst, sorgt das in der Gemeinschaft für Gerede.» Viele Frauen hätten Angst, so ihren guten Ruf zu verlieren und später keinen geeigneten Partner zu finden, glaubt Havin.
Heute versucht sie die Vergangenheit hinter sich zu lassen, möchte sich ganz auf ihre Kinder konzentrieren. «Ich will ihnen all das geben, was ich selbst nie hatte», sagt Havin, «ich will für sie da sein, mit ihnen offen über alles reden können.» Und lächelnd fügt sie hinzu: «Mit meinem jetzigen Mann ist das machbar.»
*Name von der Redaktion geändert.

ist Gründerin und Chefredaktorin des Online-Magazins baba news.

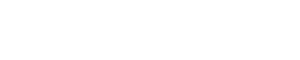

Liebste Havin, wenn Ihr euch damals islamisch getraut habt, dann war diese Trauung ungültig, also brauchst du keine Scheidung, denn eine Zwangsheirat ist haram. Auch ist es im KRG (Nord Irak) verboten, das heisst, man würde dir helfen eine Strafanzeige gegen deine Familie einzuleiten, wenn du dies wünschst. Mir tut es aus tiefstem Herzen leid, was du erleben musstest! Es gibt immer schwarze Schafe, trotzdem, wir sind nicht alle so! Wenn du dir trotzdem eine kurdische „Familie“ wünschst — es gibt genügend von uns (meine Familie, ich selber bin CH) in Zürich und unser Herz ist für dich und deine kleine Familie geöffnet! Meine Angaben kannst du beim Admin nachfragen.
Ich habe Havins Geschichte während meinen Weihnachtsferien gelesen. Ihr Schicksal hat mich sehr berührt und ihr Mut und Kampfgeist beeindruckt! Es hat mich an die Geschichte von Betty Mahmoudi erinnert —> Buch ( nicht ohne meine Tochter). Ich wünsche ihr alles Glück der Welt und dass Sie diese Erlebnisse gut verarbeiten und hinter sich lassen wird und mit ihrem neuen Mann an ihrer Seite tiefe Liebe, Geborgenheit und Sicherheit finden wird.
Das tut mir leid, was dieses Mädchen alles durchmachen musste. Ich hoffe, dass sie trotz der schlimmen Erlebnisse etwas Gutes für sich aus der Sache herausnehmen konnte.