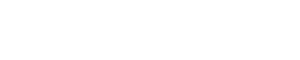Covid-19 hat vielen «Shacis» einen Strich durch die Ferienplanung gemacht. Wonach sie sich sehnen, beschreibt Gastarbeiterin Arzije.
Ich sitze auf meinem Bürostühl und arbeite. In voller Lautstärke läuft albanische Popmusik. Es ist nicht mal unbedingt mein Musikgeschmack, doch während ich lauthals mitsinge, verspüre ich plötzlich ein sehr starkes Heimweh nach dem Kosovo. Ich geniesse alles, was mich daran erinnert. Momentan ist es eben dieser Popsong «Anna» von Nora Istrefi.
Vor allem jetzt, wo wir wegen Covid-19 nicht hin dürfen, ist mein Verlangen um so stärker dahin zu reisen. Haben sich meine Eltern wohl so gefühlt, als sie in die Heimat wollten, aber nicht konnten, weil sie hier in der Schweiz arbeiten mussten? Mein Herz schlägt immer noch stark gegen meine Brust. Mittlerweile bin ich aufgestanden und versuche zu diesem langsamen Beat mitzutanzen. Ich sehe die Strassen Pristinas vor mir.
Mir würde es nichts mehr ausmachen, wenn mich meine Verwandten und Freund*innen mit «Shaci»* begrüssen würden. Ich würde sie direkt in meine Arme schliessen und bis spät in die Nacht mit ihnen zusammen Zigaretten rauchen, Chipsy mit Ketchup-Geschmack knabbern und über Gott und die Welt philosophieren. Ich kann die Hochzeiten im Kosovo nicht ausstehen, aber auch das würde ich mir jetzt antun. Ich würde eine kalte Fanta Exotic trinken und dazwischen versteckt einige Schlucke Raki hinunterkippen. Wenn der Raki seine Wirkung erlangt hatte, würde ich zusammen mit meinem Vater angetrunken Tallava tanzen, obwohl ich die Schritte gar nicht kann.
Mir würde es nichts mehr ausmachen, wenn mich meine Verwandten mit «Shaci» begrüssen würden.
Am nächsten Tag würde ich dem «Shaci»-Stereotyp voll nachkommen. Ich würde mit heruntergekurbeltem Fenster und lauter Musik die Strassen Pristinas hinauf und hinab fahren. Zum Frühstück würde ich mir beim Stand um die Ecke einen frischen Börek mit Spinat holen. Den ganzen Tag lang würde ich die verschiedenen Cafés abklappern und einen Cappuccino nach dem anderen trinken. Am späten Nachmittag würde ich mir dann an der Hauptpromenade ein Eis kaufen und auf den Sitzbänken neben der Skanderbeg-Statue verweilen, bis die Sonne unterging und es Zeit wurde, sich für den Abend herzurichten.
Gegen Mitternacht würde ich an den Stadtrand Pristinas hinausfahren, wo einige Nachtclubs stehen. Ich würde mit hunderten anderen anstehen, bis ich endlich hinein könnte. Nur um dann mit den anderen Shacis aus der Diaspora die Nacht durchzutanzen. Die einheimischen Jugendlichen würden uns von der Ferne aus argwöhnisch betrachten und es kaum erwarten, bis ihre geliebte Stadt wieder in den Normalzustand zurückkehren würde. Die Preise wieder gesenkt würden und an den Partys wieder Techno liefe, und nicht diese schwachsinnige Popmusik, die sich die Shacis immer wünschten.
Ich würde mit lauter Musik die Strassen Pristinas hinauf und hinab fahren.
Um circa sechs Uhr morgens würde ich dann wieder den Hügel hinunter zurückfahren. Die Skyline Pristinas würde mich im Schein der goldigen Morgensonne begrüssen und ich würde noch einen kurzen Halt machen in diesem Restaurant, bei dem alle nach dem Feiern noch eine Pizza verdrückten.
Nach dem intensiven Shaci-Tag würde ich in das Dorf verschwinden, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Ich würde die gelbe, trockene Erde anfassen und die frische Luft tief in meine Lunge einatmen. Aus dem Garten würde ich «Speca» (lange, grüne Peperoni) pflücken, die ich später auf den Grill legen würde. Ich hätte irgendwelche Hausschuhe meiner Tante an, die viel zu klein wären für meine Füsse. Wenn es dann draussen dunkelte, würde ich mich auf den Balkon setzen und den Grillen zuhören, bis der Gesang des Imams ihr Zirpen unterbrach. Der sanfte Gesang würde mich an meine verstorbene Grossmutter erinnern, die früher, als sie noch lebte, immer zu seinem Gesang gebetet hatte. Mit Tränen im Gesicht und meinen Kopf an die Schulter meiner Mutter gelehnt würde ich, ohne Decke, bei den warmen Temperaturen des Abends friedlich einschlafen.
Das Lied von Nora Istrefi ist nun zu Ende und ich setze mich wieder an meinen Schreibtisch.
*Das Wort «Shaci» ist eine stereotype Repräsentation der Albaner*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und eine Methode der Selbsterniedrigung.