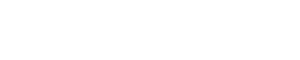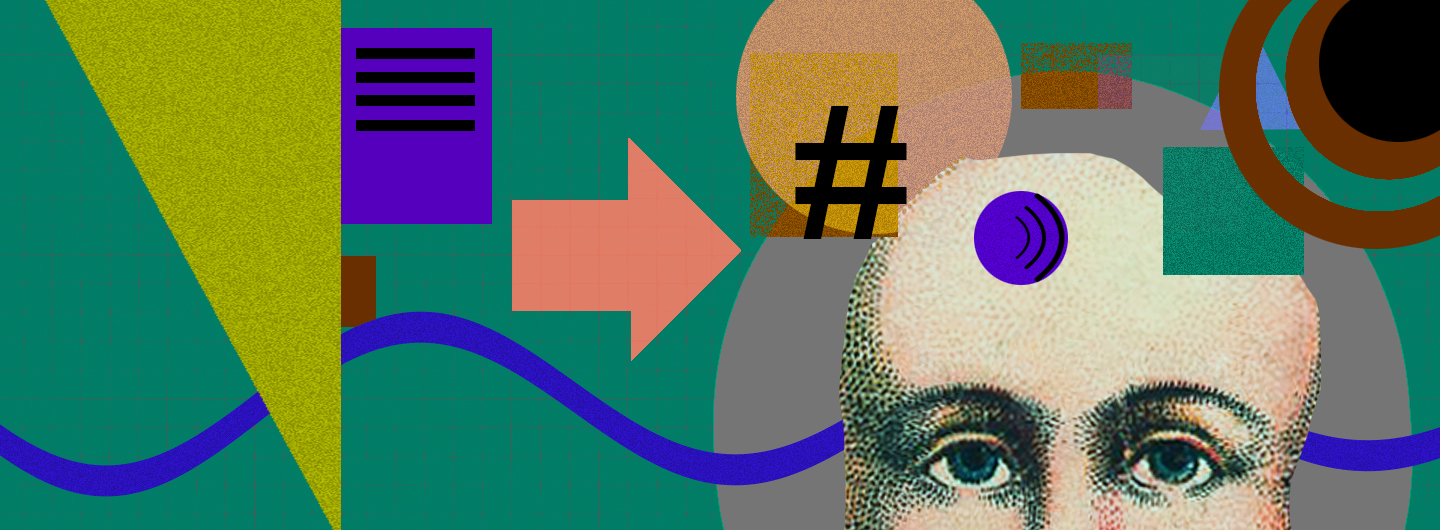Am 13. Februar wird über eine Erweiterung der Medienförderung abgestimmt. Wir sprachen mit Medienwissenschaftler Manuel Puppis über die Befürchtungen des Referendumskomitees, die Förderung von Onlinemedien und darüber, was ein Nein für die lokale Berichterstattung bedeuten würde.
Mit dem Massnahmenpaket zur Medienförderung wollen Bund und Parlament die lokalen und regionalen Medien stärken, weil diese besonders stark unter Druck sind, für das Funktionieren eines demokratischen Systems aber eine zentrale Rolle spielen. Wie stark würden die Massnahmen tatsächlich vor allem die lokale Berichterstattung stärken?
Grundsätzlich würde mit dem Massnahmenpaket tatsächlich die Regional- und Lokalberichterstattung gestärkt. Denn das Massnahmenpaket sieht vor, dass jedes Förderelement – Posttaxenverbilligung, Frühzustellung, Onlinemedienförderung – degressiv ausgestaltet ist. Das heisst, kleine Medien würden prozentual mehr profitieren als grosse: Sie erhielten pro Zeitungsexemplar oder pro Umsatzfranken mehr Geld als ein grosser Anbieter.
«Man hätte früher etwas unternehmen müssen, um noch mehr Regional- und Lokalberichterstattung zu bewahren.»
Allerdings hätte man in der Schweiz schon vor Jahrzehnten mehr machen müssen, um noch mehr Regional- und Lokalberichterstattung zu bewahren: Indem man etwas gegen die Medienkonzentration unternommen oder mit Fördermassnahmen eingegriffen hätte. Daher haben wir heute bereits eine sehr stark konzentrierte Medienlandschaft mit Grossverlagen, bei denen die überregionale Berichterstattung aus Zentralredaktionen kommt. Inzwischen gehören auch viele Regional- und Lokalzeitungen Tamedia oder CH Media. Daher würden diese ebenfalls von den Posttaxenverbilligungen profitieren. Aber letztlich verkleinern Fördermassnahmen die Gefahr, dass auf Regional- und Lokalredaktionen weiter gespart wird oder diese sogar ganz geschlossen werden.
Das Referendumskomitee behauptet nun, dass sogar ein Grossteil der Fördergelder bei grossen Medienhäusern landen wird. Wie ist dieser Kritikpunkt einzuschätzen?
Es ist schwierig zu sagen, wie viel die grossen Verlage erhalten werden, weil die Details erst auf der Verordnungsebene festgelegt würden. Was man aber sagen kann: Die Posttaxenverbilligung soll – gemäss einer Ankündigung des BAKOM-Direktors – weiterhin zu 75 % den kleineren und mittleren Verlagen zugutekommen. Und von der Unterstützung der lokalen Radio- und Fernsehanbieter würden weiterhin nur ca. 17 % an ein grosses Medienhaus gehen. Bei der Frühzustellung wage ich keine Prognose. Wie stark die kleineren und mittleren Verlage profitieren würden, hängt davon ab, wie viele ihrer Zeitungen auf Frühzustellung umstellen. Und von der Förderung der Onlinemedien würde gemäss der Berechnung des BAKOMs ungefähr die Hälfte an die grossen Medienhäuser gehen. Dies steht jedoch noch nicht fest und hängt von der Umsetzung durch den Bundesrat ab. Man kann also sagen: Es stimmt zwar, dass die grossen Medienkonzerne auch Geld erhalten würden. Aber es stimmt sicher nicht, dass diese Beiträge den grössten Teil des Fördergelds aus dem Massnahmenpaket ausmachen würden.
«Die grossen Medienkonzerne würden nicht den grössten Teil des Fördergelds erhalten.»
Vor allem muss man sich aber fragen, was die Alternative ist: Wenn man nur Medien fördern will, hinter denen kein Grossverlag steht, kommen – vor allem bei den Lokal- und Regionalzeitungen – nur noch ganz wenige in Frage. Und wenn man den grossen Medienhäusern kein Geld gibt, stellt sich die Frage, ob diese dann nicht irgendwann einfach ihre Lokal- und Regionalredaktionen schliessen würden. Denn viele rentieren nicht mehr. Die Frage wäre dann also, wie lange sich die grossen Medienhäuser überhaupt noch Lokal- und Regionalzeitungen leisten würden.
Weiter befürchtet das Referendumskomitee, dass es durch die Fördermassnahmen zu staatlicher Einflussnahme auf die Inhalte der geförderten Medien käme. Was sagen Sie zu diesen Bedenken?
Diese Bedenken sind auf jeden Fall insofern legitim, als dass man sich diese Fragen immer stellen muss. Es ist absolut wichtig, dass Medien unabhängig vom Staat funktionieren können und es keine Einmischung in redaktionelle Entscheidungen gibt. Letztlich sind diese Befürchtungen im Fall dieses Massnahmenpakets aber nicht gerechtfertigt.
Die Schweiz kennt indirekte Presseförderung praktisch seit Beginn des Bundesstaates und seit Jahrzehnten auch die direkte Förderung von Regionalradio- und Fernsehsender. Und doch unterstellt niemand ernsthaft, dass es sich bei den bisher geförderten Medien um Staatsmedien handelt. Weiter hat die Schweiz auch die SRG, die mit öffentlichen Geldern finanziert ist. Trotzdem ist die Schweiz bei allen internationalen Erhebungen zur Pressefreiheit immer bei den vordersten Plätzen dabei.
«Es gäbe keinen Hebel, um bei missliebiger Berichterstattung Subventionen zu kürzen.»
Die Frage ist nun: Würde sich mit dem vorliegenden Massnahmenpaket etwas daran ändern? Die indirekte Förderung kennen wir heute schon, da würde sich also nichts ändern. Die direkte Förderung von Onlinemedien wäre neu und war auch im Parlament am umstrittensten. Sie ist jedoch im Massnahmenpaket so ausgestaltet, dass die Entscheidung über die Geldzuweisung nicht vom Inhalt abhinge. Es gäbe keinen inhaltlichen Leistungsauftrag, wie das beim Service public der Fall ist, ebenso wenig wie eine inhaltliche Evaluation oder Berichterstattung. Ein Onlinemedium, welches bestimmte formale Kriterien erfüllt – z.B. die Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten und das Einhalten berufsethischer Normen – und Gelder beantragen will, erhielte diese ziemlich automatisch. Es gäbe also keinen Hebel, um bei missliebiger Berichterstattung Subventionen zu kürzen.

Prof. Manuel Puppis ist ordentlicher Professor für Medienstrukturen und Governance am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Freiburg. Im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation leitete er ein Forschungsprojekt zu direkter und indirekter Förderung von Onlinemedien in verschiedenen europäischen Staaten.
Trotzdem ist die Förderung der Onlinemedien nun auch im Abstimmungskampf eine der umstrittensten Massnahmen. Weshalb genau ist diese derart kontrovers?
Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits hat dies damit zu tun, dass es sich – wie bereits erwähnt – um direkte Förderung handelt. Denn anders als bei Zeitungen kann man Onlinemedien nicht indirekt unterstützen, indem man etwa den Transport vergünstigt. Wenn man sie also unterstützen will, muss man direkt Gelder an die Medien bezahlen, damit die Redaktionen über mehr Mittel verfügen. Dies führt dann zur Angst, dass der Staat durch diese direkte Förderung Einfluss auf die redaktionellen Inhalte bekäme. Diese Angst ist jedoch – wie vorher ausgeführt – unbegründet.
Der zweite Grund ist, dass es durchaus Akteur*innen in der Medienbranche und der Politik gibt, die überzeugt sind, dass Förderung im Onlinebereich nicht nötig ist. Sie gehen davon aus, dass sich die Finanzierung von Onlinemedien auf dem Markt regeln lässt; d.h., dass Onlinemedien sich allein durch Publikums- und Werbeeinnahmen finanzieren lassen. Im Moment gibt es jedoch wenig Anzeichen dafür, dass diese Einnahmen ausreichen. Dafür sind viele Lokal- und Regionalmärkte zu klein. Vor allem überregionale Anbieter mit entsprechender Reichweite profitieren von Onlinewerbung, z.B. die kostenlosen Onlineportale grosser Medienhäuser. Die allermeisten Werbegelder gehen jedoch inzwischen an Kleinanzeigenportale und zu internationalen Plattformen wie Facebook, Instagram, Google, Youtube usw. Werbung ist heute schlicht nicht mehr auf Medien angewiesen, um Leute zu erreichen. Daher ist sie für viele Onlinemedien nicht wirklich ein ausreichendes Finanzierungsinstrument.
«Werbung ist heute schlicht nicht mehr auf Medien angewiesen, um Leute zu erreichen.»
Bei Publikumseinnahmen ist es ebenfalls schwierig: Laut einer Erhebung sind heute nur 17 % der Bevölkerung bereit, für Onlinemedien zu bezahlen. Die Bereitschaft hat sich in den vergangenen Jahren etwas erhöht und dürfte zukünftig noch einmal etwas steigen. Aber dennoch glaube ich nicht, dass dies ausreichen wird, damit Onlinemedien ohne staatliche Unterstützung auskommen. Sollte sich aber in den nächsten Jahren zeigen, dass marktliche Lösungen funktionieren, könnte man die Förderung der Onlinemedien wieder auslaufen lassen. Das Gesetz ist ohnehin auf sieben Jahre befristet.
In Zeiten der Digitalisierung konsumieren immer mehr Menschen Medien nur noch online, auch solche, die gleichzeitig eine Print-Ausgabe produzieren. Warum werden denn Print-Produkte weiterhin gefördert?
Man darf nicht vergessen, dass Print-Produkte immer noch gut genutzt werden. Viele Regional- und Lokalzeitungen verdienen ihr Geld weiterhin damit – d.h. mit Print-Abonnements sowie lokaler bzw. regionaler Werbung im Print-Produkt. Daher können sie nicht komplett auf online umstellen, da dadurch der Grossteil ihrer Einnahmen entfallen würde. Obschon auf dem absteigenden Ast, ist Print also keineswegs tot.
Dennoch ist die zunehmende Digitalisierung unbestreitbar. Wie trägt das Massnahmenpaket diesem Trend in der Medienbranche Rechnung?
Weil die Nutzung von Onlinemedien in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist es natürlich richtig, dass nun auch Onlinemedien gefördert werden. Wichtig scheint mir auch, dass als Folge des Massnahmenpakets nicht nur bestehende Online-Angebote unterstützt würden, sondern auch Start-ups eine Chance erhalten. Zu diesem Zweck ist für neue Onlinemedien der erforderliche Mindestumsatz pro Jahr in den ersten drei Jahren tiefer angesetzt.
«Mein Wunschpaket würde noch stärker auf digitale Produkte setzten.»
Mein Wunschpaket würde jedoch noch stärker auf digitale Produkte setzen. Aber die vorgesehenen 30 Millionen würden Förderbeiträge ermöglichen, welche für die kleinen Online-Anbieter durchaus bedeutend wären. Eine weitergehende Innovationsförderung ist jedoch leider nicht vorgesehen. Andere Länder – z.B. die Niederlande oder Deutschland – sind in diesem Bereich, z.B. mit «journalism labs», viel aktiver.
Um künftig staatliche Förderung zu erhalten, müsste ein Onlinemedium von seinen Leser*innen mitfinanziert werden. Welche Überlegung steckt hinter dieser Regelung?
Dieses Förderkriterium orientiert sich stark an der Posttaxenverbilligung, von welcher Gratiszeitungen ebenfalls nicht profitieren. Die Idee des Bundesrats war es, dass Leser*innen auch einen Beitrag leisten sollen und man diejenigen Medien unterstützen will, die auf dem Publikumsmarkt auch einen gewissen Erfolg haben. Natürlich könnte man sagen, dass auch rein werbefinanzierte Medien auf dem Publikumsmarkt ihren Erfolg unter Beweis stellen können. Letztlich ist dies also eine politische Entscheidung. Und dahinter stand wohl schon auch die Hoffnung, dass nach den sieben Jahren, auf die das Massnahmenpaket befristet ist, die Transformation geschafft ist und sich die Onlinemedien dann auf dem Publikumsmarkt finanzieren können.
«Die Idee des Bundesrats war es, dass Leser*innen auch einen Beitrag leisten sollen.»
Auch international ist es übrigens fast überall so, dass nur Medien mit Abo-Modell gefördert werden. Das Schweizer Modell zur Förderung von Onlinemedien ist jedoch insofern zukunftsweisend, als es auch Medien mit Spenden- oder Community-Modellen berücksichtigt.
Zusätzlich sieht das neue Mediengesetz einen Mindestumsatz vor, den ein Onlinemedium durch seine Nutzer*innen erreichen muss. Warum wurde diese Hürde eingebaut?
Die Idee des Bundes ist hierbei, dass keine Medien unter der Wahrnehmungsgrenze – böse ausgedrückt: Bagatellmedien – gefördert werden. Aber natürlich kann publizistische Leistung und eine Leser*innenschaft auch mit anderen Einnahmequellen – z.B. Werbung oder Stiftungen – aufgebaut werden. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass sich die Förderung stark an der Bereitschaft von Nutzer*innen, für ein Medium zu bezahlen, orientiert.
Sie haben erforscht, auf welche Weise verschiedene europäische Staaten Onlinemedien fördern. Wie würde die Schweiz bei Annahme des Massnahmenpakets im europäischen Vergleich dastehen?
Wie auch in der Schweiz ist die grösste Fördermassnahme in allen europäischen Ländern der tiefere Mehrwertsteuersatz auf Medienprodukte. In der EU fällt dies sogar noch stärker ins Gewicht als in der Schweiz, weil die Mehrwertsteuer dort viel höher ist.
«Die meisten Länder in Europa sind längst dazu übergegangen, Medien direkt zu fördern.»
Aber es gibt in Europa kaum noch Länder, die Posttaxen verbilligen. Dies tun nebst der Schweiz beispielsweise Belgien, Frankreich und Italien. Die meisten Länder sind längst dazu übergegangen, Medien direkt zu fördern, und zwar sowohl im Print- als auch im Onlinebereich. Das Modell, welches die Schweiz nur für Onlinemedien vorsieht, entspricht dabei der Art, wie viele andere Länder Print- und Onlinemedien fördern.
Was weiss man aus anderen Ländern über die Wirkung von Fördermassnahmen für private Medien?
Untersuchungen zeigen, dass kein Zusammenhang zwischen staatlicher Medienförderung und Pressefreiheit besteht: Es gibt Länder mit direkter Medienförderung, deren Mediensysteme zu den freisten gehören. Aber man weiss auch, dass es, um staatlicher Einflussnahme vorzubeugen, wichtig ist, dass der Staat nicht die einzige Einnahmequelle ist.
«Förderung hat keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Qualität der Medien.»
Es gibt jedoch nur wenig Forschung dazu, wie sich Förderung auf die Struktur des Mediensystems oder die inhaltliche Berichterstattung auswirkt. Eine Ausnahme ist die Studie eines norwegischen Forschungsteams, welches geförderte und nicht-geförderte Medien mittels einer automatisierten Inhaltsanalyse miteinander verglichen hat. Demnach berichten geförderte Medien etwas mehr über Lokalpolitik und die lokale Wirtschaft, ansonsten fanden die Forscher*innen jedoch keine Unterschiede. Ihre Schlussfolgerung war: Förderung hat keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Qualität der Medien, wohl aber auf ihr Überleben.
Wenn das Massnahmenpaket am 13. Februar abgelehnt würde, was würde das für die Schweizer Medienlandschaft bedeuten?
Die Posttaxenverbilligung würde weiterlaufen, aber zu weitaus tieferen Ansätzen als dies im Massnahmenpaket vorgesehen ist. Für viele Lokal- und Regionalzeitungen wäre das eine Einschränkung, weil sie so zu wenig Ressourcen hätten, um parallel ein Online-Angebot aufzubauen. Und für Online-Anbieter hiesse ein Nein am 13. Februar, dass diejenigen, welche kein funktionierendes Geschäftsmodell finden, eingehen oder stark abspecken müssten.
Gehen Sie davon aus, dass ein Ausbau der Medienförderung bei einem Nein am 13. Februar vorerst politisch erledigt wäre?
Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall das Parlament in den nächsten Jahren noch einmal einen Anlauf nehmen würde, um die Print-Förderung auszubauen. Die Förderung von Onlinemedien wäre jedoch vermutlich für längere Zeit vom Tisch.
- Die Zustellung von abonnierten Zeitungen wird stärker vergünstigt (mit zusätzlichen 20 Mio. Franken pro Jahr).
- Neu wird auch die Frühzustellung von Zeitungen vergünstigt (mit jährlich 40 Mio. Franken).
- Die Förderung von privaten Lokalradios und Regionalfernsehstationen wird ausgebaut (mit zusätzlichen 28 Mio. Franken pro Jahr).
- Neu werden auch Onlinemedien gefördert. Onlinemedien, die von Leser*innen mitfinanziert werden, erhalten pro Jahr insgesamt 30 Mio. Franken.
- Die Nachrichtenagenturen und die Aus- und Weiterbildung von Journalist*innen werden gestärkt (mit jährlich 23 Mio. Fr.).