Gastarbeiter Suad hat von seinem Vater den Kosenamen «Hans» bekommen. Dahinter steckt mehr als ein gewöhnlicher Spitzname.
Eltern sind ja bekanntlich Weltmeister darin, ihren Kindern schrecklich liebevolle Kosenamen zu geben. Meine albanischen Eltern sind da nicht anders. Doch statt Dauerbrennern wie «Zemër», hat mein Vater einen ganz besonderen Spitznamen für mich: «Hans». Ja, richtig gelesen. «Hans».
Es muss irgendwann mal harmlos angefangen haben. Ich nehme an, ich habe als Kind etwas gemacht, was meinem Vater nicht «albanisch» genug war. Wenn ich ehrlich bin, muss es wohl für ihn eine ganze Reihe solcher Momente gegeben haben. Denn: Bei mir zu Hause hiess albanisch Aufwachsen, dass ich gewisse albanische Attribute erfüllen musste. Natürlich spielt nicht jede albanische Familie dieses Klischee-Bingo mit ihren Kindern, meine aber schon. Jedes Mal also, wenn ich mich für den Geschmack meines Vaters nicht «albanisch» genug verhielt, wurde ich – anfangs noch liebevoll – zum «Hans» abgestempelt. Ein «Hans» ist für meinen Vater der Spiesser-Schweizer schlechthin.
Ein «Hans» ist für meinen Vater der Spiesser-Schweizer schlechthin.
Als Kind war es leichter zu erkennen, wenn ich mich wie ein «Hans» benahm. Wenn ich lieber zu Hause blieb um zu lesen, statt mit meinem Vater Occasion-Autos angucken zu gehen. «Du, Hans!» Oder wenn ich mir zum Geburtstag Rollschuhe wünschte, und nicht eine der unzähligen Doppelkopfadler-Halsketten, die mein Vater immer stolz vom Albanienurlaub mitbrachte. Auch hier «Hans». Doch als ich älter wurde, veränderte sich mein Bezug zu diesem Spitznamen. Überhaupt die ganze Dynamik des «Hans-Seins» fühlte sich anders an. «Hans» hilft meinen Vater, sowie meiner Familie, ein Phänomen in Worte zu fassen, welche Diaspora-Albaner wohl bei einigen ihrer Kinder beobachten. Es ist ein Gefühl, welches auch ich spüre, und mir vor allem durch den Spitznamen «Hans» bewusst wird: Ich bin meiner Familie nicht albanisch genug.
Als Person mit albanischen Wurzeln musste ich gefühlt immer und überall um Akzeptanz kämpfen. Sich immer wieder erklären müssen, geduldig Fragen beantworten und Unklarheiten aus dem Weg schaffen. Immer hoffen, dass man zu «den Guten» gehört, denn erst dann, so dachte ich, kann ich als Person erkannt werden, ohne den ganzen Kontext des «Albanerseins».
Ich bin meiner Familie nicht albanisch genug.
Mir wurde erst im Erwachsenenalter so richtig bewusst, dass man selbst von seiner Familie um Akzeptanz gebracht werden kann. Vorfälle gibt es bis heute genug. Wenn auch nicht immer ein «Hans» fällt, nimmt es mitunter wirre Formen an. Als ich letztens in unserem Garten vom Fahrrad stieg, war mein Cousin zu Besuch. Noch bevor ich mein Fahrrad abschliessen konnte, wurde ich mit einem «Sogar sein Fahrrad ist so ein richtiges Schweizer Fahrrad» begrüsst. Ich war ein bisschen perplex. Meine «Hansigkeit» färbt also ab. Nicht nur mein Verhalten wird taxiert, sondern auch meinen Alltagsgegenständen eine Nationalität aufgehalst. Erklären, wie denn so ein richtig albanisches Fahrrad auszusehen habe, konnte mir mein Cousin nicht.
Wenn also selbst das eigene Zuhause einem keine Flucht ist vor dem stetigen Ringen nach Akzeptanz, sondern dieses Ringen sogar auf beiden Seiten stattfindet, dann reden wir von einem Identitätskonflikt par Excellence. Dann versucht man sich mitunter in der Öffentlichkeit so schweizerisch wie möglich zu geben, und Zuhause lässt man den Albaner zugunsten des Haussegens mehr raushängen als einem lieb ist. So wird aus dem lustigen Spitznamen «Hans» ein Wort mit tieferer Bedeutung. Er ist ein Mittel zum Zweck.
Die erhoffte Wirkung: Mich, seinen Sohn, nicht fremd werden zu lassen.
Wenn man Sprache als Mittel der Regulierung ansieht, dann ist es nicht erstaunlich, dass mein Vater «Hans» zu mir sagt. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass sich mein Vater bei dem Spitznamen nicht viele Gedanken gemacht hat – zumindest nicht so viele wie ich mir jetzt – erhoffte er sich dennoch unterbewusst eine Wirkung. Die erhoffte Wirkung: Mich, seinen Sohn der in der Schweiz geboren wurde und hier auch zur Schule ging, nicht fremd werden zu lassen. Entfremdung ist, meiner Ansicht nach, die grösste Angst. Die grösste Angst meiner Eltern und auch der Gesellschaft. Meinen Eltern war beispielsweise das hiesige Schulsystem fremd, der Gesellschaft war die Sprache meiner Eltern fremd.
Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Es ist also nicht verwunderlich, dass «Hans» mehr als ein Spitzname ist. «Hans» ist die Angst vieler Eltern, dass sich ihre Kinder nicht mehr mit ihren Werten und Traditionen identifizieren können. «Hans» ist der Wunsch vieler Eltern, dass ihre Kinder ihre Wurzeln nicht vergessen. «Hans» ist das sprachliche Werkzeug, welches die Kinder wieder daran erinnern soll, dass man nicht zu «denen» gehört, zumindest nicht ganz. «Hans» ist eine Erinnerung für die Kinder, dass sie, egal wie sehr sie sich bemühen, letztlich mit ihrem Verhalten überall anecken werden. «Hans» ist die Herausforderung die gemeistert werden muss.


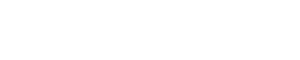
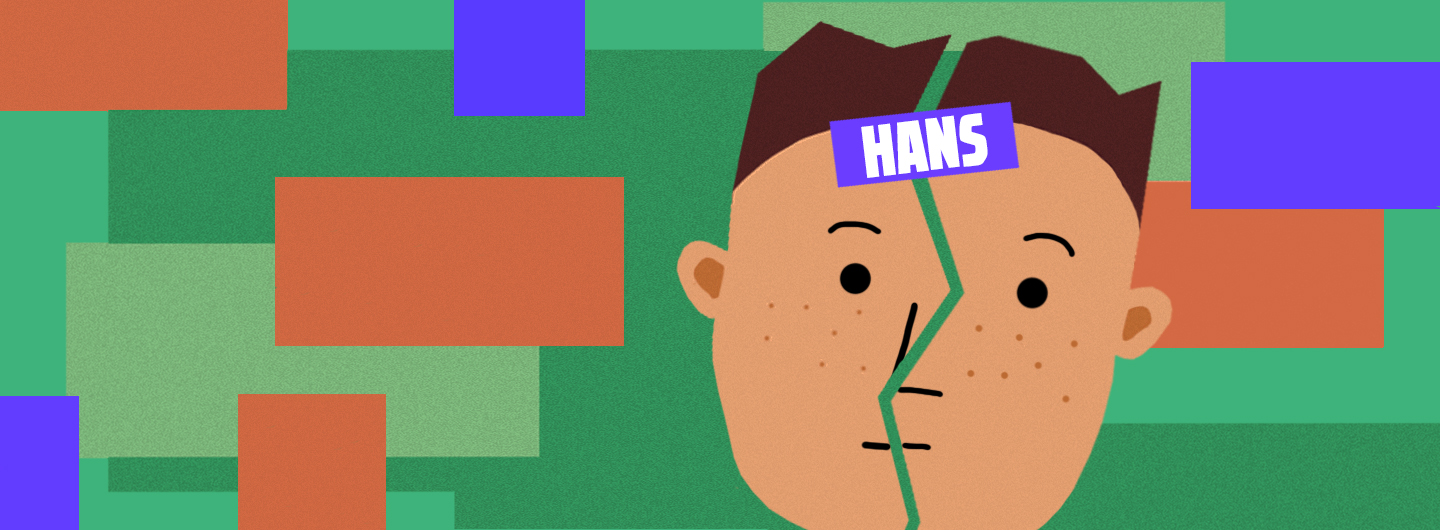
Dieser Text zeigt wunderbar auf, dass Multikulti ein künstliches Spannungsfeld erzeugt, welches meiner Meinung nach nicht nötig ist. Der Vater von “Hans” hätte ja spätestens im 2008 (Gründung des Kosovos), notabene mehrere Jahre nach dem Krieg zurück in seine geliebte Heimat gehen können? Weg von der geächteten “Hans” Kultur. Voller Elan mit einer goldigen Doppelkopf Kette um den Hals das eigene Land auf Vordermann bringen. Oder hört der Nationalstolz auf, sobald es unbequem wird? Vielleicht. Generell finde ich es falsch, dass unser Asylwesen von einer ursprünglichen temporär Lösung zu einer Integrationslösung mutiert. Diese Mutation ist grundlegend falsch, wie uns dieser Text unfreiwillig offenbart.
Sehr schöner Artikel!