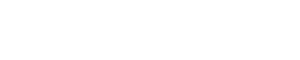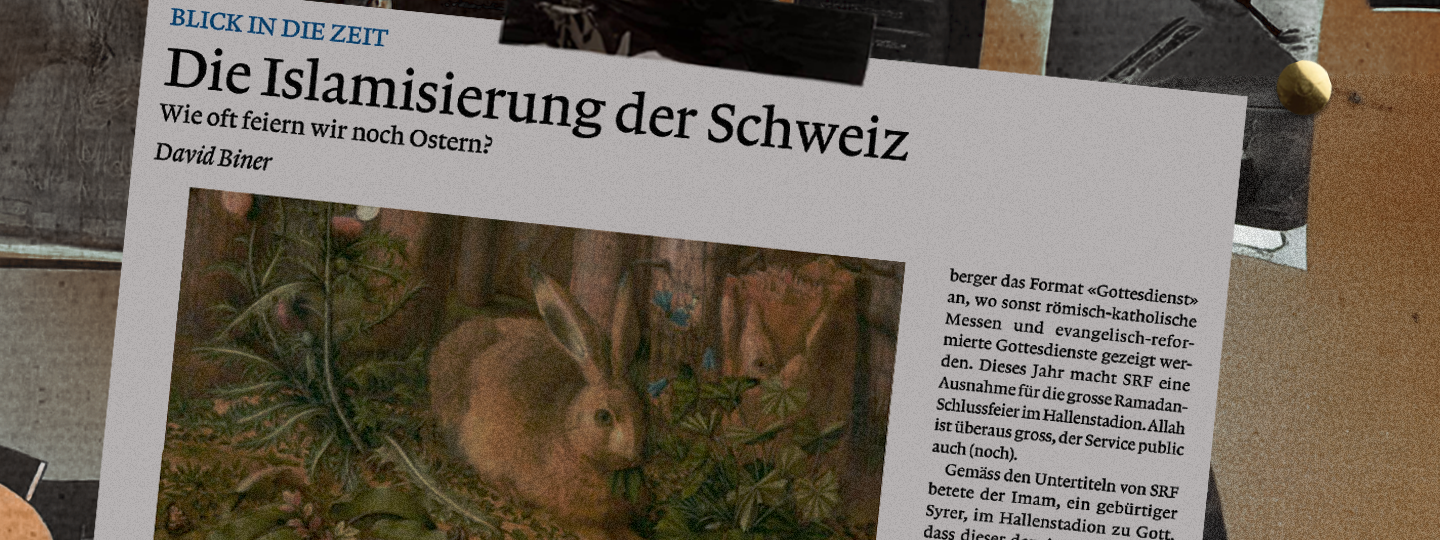Ein SRF-Beitrag zeigt muslimische Gläubige beim Eid-Gebet im Zürcher Hallenstadion – für die Weltwoche offenbar Grund genug, den kulturellen Notstand auszurufen. Doch was als Skandal verkauft wird, zeigt in Wahrheit nur eins: Menschen brauchen Platz zum Glauben. Eine Antwort auf mediale Panikmache und rassistische Narrative.
Würde man David Biners Weltwoche-Artikel Glauben schenken, könnte man meinen, der Bundesrat stehe kurz davor, seine Sitzungen mit dem islamischen Gebetsruf zu eröffnen. Was war passiert? Ein Tagesschau-Beitrag des SRF zeigte Muslim*innen beim traditionellen Eid-Gebet, die (oh Schreck!) wegen Platzmangels ins Zürcher Hallenstadion auswichen.
Anstatt eines «islamischen Staatsstreichs» oder einer «Weltneuheit» offenbarte der Tageschau-Beitrag des SRF etwas viel Banaleres: Dass religiöse Gemeinschaften, ob christlich, jüdisch oder muslimisch, schlicht Räume brauchen, um zu feiern. Dass ausgerechnet ein Hallenstadion, sonst Tempel für Hockey und Popkonzerte, zum Gebetsort wurde, ist keine Hiobsbotschaft, sondern ein Beleg für Vielfalt und pragmatische Lösungen.
Doch die Weltwoche, betrieben von SVPler und Chefredaktor Roger Köppel (der nebenbei auch gern mal offen rechtsradikale Populist*innen wie Alice Weidel als Gastkommentator*innen einlädt), sieht in dem Beitrag nur eines: den Untergang des Abendlandes – heraufbeschworen durch stille Gebete in einer Sporthalle.
Anstatt über religiöse Vielfalt zu berichten, schreibt Köppels Blatt lieber Horror-Stories über harmlose Hallennutzungen und schürt dabei tief rassistische Ängste. Kommt als nächstes der Vorwurf, das Hallenstadion würde in Zukunft nur noch Halal-Gerichte verkaufen und die Strafraumlinien nach Gebetsrichtung ausrichten? Werfen wir einen Blick auf den Artikel.
Dass ausgerechnet ein Hallenstadion (…) zum Gebetsort wurde, ist keine Hiobsbotschaft, sondern ein Beleg für Vielfalt und pragmatische Lösungen.
Mekka, Jerusalem, Oerlikon – und die Macht der Zahlen
Weltwoche-Redaktor Biner rechnet eifrig vor: Während 1970 noch alle Schweizer Muslime ins Hallenstadion passten, sind es heute mittlerweile 500’000. Ein alarmierender Trend? Oder schlichtweg das Ergebnis von Einwanderung (von der die Schweiz fabelhaft profitiert) und Globalisierung, gepaart mit der Tatsache, dass Menschen ihr Recht auf Religionsfreiheit wahrnehmen?
Dass der Anteil der Christ*innen schrumpft, liegt nicht an der «Import-Islamisierung», sondern an der Säkularisierung und eigenen Glaubensvorlieben. Aber eine tief rassistisch verwurzelte Sichtweise auf den «verschwörerischen Islam», der sich langsam im Dunkeln ausbreiten und alles einnehmen würde, verkauft sich schlichtweg besser, weil sie mit Angst und rassistischen Vorurteilen spielt.
So wird auch die Geschlechtertrennung beim Gebet im Weltwoche-Artikel als Rückschritt ins Patriarchat dargestellt. Doch was, wenn dies für viele Frauen einen bewussten und geschützten Rückzugsraum darstellt – ähnlich wie Frauen-Yoga oder Frauenschwimmen? Pauschale Urteile über «Unterdrückung» ignorieren die Selbstbestimmung der Betroffenen.
Eine Teilnehmerin betont im SRF-Beitrag: «Wir sind Muslime, wir sind in der Schweiz.» Hier klingt kein missionarischer Eifer, sondern der Wunsch nach Zugehörigkeit. Nicht jede kulturelle Differenz muss zum Kulturkampf eskalieren. Wer hier eine «politische Agenda» wittert, übersieht: Inklusion heisst nicht, das Christentum zu verraten, sondern Vielfalt zu leben.
Hier klingt kein missionarischer Eifer, sondern der Wunsch nach Zugehörigkeit.
Dass der Bundesrat Beat Jans das Fastenbrechen besucht oder am Karfreitag schweigt und Ostern privat feiert, wird im Weltwoche-Artikel als Beweis für «Islam-Hörigkeit» gedeutet. Vielleicht ist es aber auch einfach Respekt vor der Stille eines Feiertags – oder die Einsicht, dass Religion auch Privatsache sein darf?
Die Frage «Wie viel Islam verträgt die Schweiz?» stellt deshalb eine falsche Dichotomie dar. Eine offene und demokratische Gesellschaft sollte katholische Prozessionen, jüdische Feiertage und muslimische Gebete unter einen Hut bringen können.
Kriminalität und Herkunft: Einfache Antworten auf komplexe Fragen
Der Artikel bemüht ebenfalls Kriminaldaten, um Muslime*innen unter Generalverdacht zu stellen. Afghanen, Marokkaner, Tunesier – allesamt «importierte Gewalt»? Als Quelle wird unter Anderem das Buch des ehemaligen forensischen Psychiaters Frank Urbaniok «Schattenseiten der Migration» herangezogen. Seine These: Bestimmte Nationalitäten begehen «importierte Gewalt». Afghanen fünfmal, Marokkaner achtmal häufiger als Schweizer?
Das klingt nach Alarmstufe Rot – bis man die Zutatenliste prüft: Urbanioks Rezept blendet nämlich aus, dass junge Männer generell gewaltaffiner geworden sind, egal ob aus Zug oder Kabul. Über die Ursachen lässt sich diskutieren; bei Migranten wird jedoch jede Rangelei zum «Kulturkampf» hochstilisiert, beim einheimischen Säufer heisst es «Jugendsünde».
Wenn afghanische Jugendliche in der Schweiz straffällig werden, liegt das nicht am Islam, sondern daran, dass viele als Geflüchtete jahrelang in Lagern hockten.
Dass Urbaniok lange keinen Verlag fand, der sein Buch herausgeben wollte, ist kein Zufall. Es bedient ein Narrativ, das weniger mit Fakten als mit selektiver Empörung arbeitet. Wie baba news in einer Analyse zeigt, werden Kriminalstatistiken oft zum Angst-Bouquet gebunden: Man pflückt Rosinen wie Herkunft, ignoriert aber Wurzeln wie Armut, Traumata oder strukturellen Rassismus.
Ein Beispiel: Wenn afghanische Jugendliche in der Schweiz straffällig werden, liegt das nicht am Islam, sondern daran, dass viele als Geflüchtete jahrelang in Lagern hockten – ohne Bildung, Perspektiven oder Therapie für erlittene Kriegsgräuel. Das ist kein Freibrief, aber ein Hinweis darauf, dass Integration scheitert, bevor sie beginnt.
Fazit: Schattenboxen gegen Scheinriesen
David Biners Artikel ist kein Aufklärungswerk, sondern ein Symptom der Angst vor dem Unbekannten – wie ein Kind, das im Dunkeln Monster wähnt, bis die Mutter das Licht anschaltet. Die Schweiz hat Herausforderungen, aber die liegen nicht im Hallenstadion oder im Islam, sondern in den Köpfen jener, die Vielfalt als Schwäche statt als Stärke sehen. Wer mit vereinfachten Statistiken und rassistischen Ressentiments hetzt, macht aus der Auslebung religiöser Vielfalt einen Prügelknaben – und lenkt von den echten Problemen ab.
Das Hallenstadion war voll, nicht weil der Islam expandiert, sondern weil die Schweiz lernt, Platz zu machen.
Zum Schluss eine Frage an den Autor: Würden Sie lieber in einer Schweiz leben, in der Muslim*innen im Verborgenen beten – oder in einer, die offen zeigt, wie Diversität funktioniert? Das Hallenstadion war voll, nicht weil der Islam expandiert, sondern weil die Schweiz lernt, Platz zu machen. Und das ist keine Bedrohung, sondern ein Kompliment an unsere Fähigkeit, Lebensrealitäten – und Hallen –, zu teilen. In dem Sinne: Lasst uns weniger Angst vor Schattenseiten haben und mehr Licht anmachen.
Von Ayaan Mehdi