Ein rassistisches Zitat von Sascha Ruefer sorgte für Aufruhr – weil es von der WoZ als rassistisch bezeichnet worden war. Nun will sich Sascha Ruefer reinwaschen, indem er «Kontext» liefert. Was an der Debatte problematisch ist, und was sie über uns aussagt.
Was ist passiert?
Vor rund drei Wochen erschien auf SRF «The Pressure Game» eine Doku, in welcher ein Filmteam die Schweizer Nati im Rahmen der WM in Katar begleitete. Auch Sascha Ruefer, Kommentator der Schweizer Länderspiele, kam darin zu Wort. Ende März machte die Aargauer Zeitung schliesslich publik, Sascha Ruefer habe eine Aussage in «The Pressure Game» entfernen lassen. Die Aussage, in der sich Ruefer über Granit Xhaka äusserte, könne als rassistisch ausgelegt werden. Das SRF war nicht bereit, die Passage zu veröffentlichen, und liess lediglich verlauten, die Aussage sei aus dem Kontext gerissen worden.
Vor einer Woche enthüllte schliesslich die WoZ den Satz, der nicht in die Öffentlichkeit hätte gelangen dürfen: «Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer.» Nachdem erneut weder Sascha Ruefer noch das SRF Stellung nahmen, kommentierte WoZ-Redaktor Renato Beck: «Es ist auch schwer vorstellbar, wie dieser (Kontext) sein könnte, damit Ruefers Aussage nicht so wirkt, wie sie es jetzt tut: unglaublich anmassend – und rassistisch. Am Tag darauf lud SRF-Sport verschiedene Medien (baba news war nicht darunter) ein, sich die Originalaufnahmen des fraglichen Satzes in einem Sitzungszimmer des SRF-Studios anzusehen.
Das den Medienleuten vorgeführte Rohmaterial der Doku dauerte rund 45 Minuten. Darin habe Ruefer «sehr ausführlich und differenziert über seine Beziehung zu Granit Xhaka» gesprochen (Watson), den er «als Spieler und Mensch schätze und respektiere, an dessen Charakter er sich auch reibe». Nach ca. 45 Minuten Gesprächszeit war das offizielle Interview für «The Pressure Game» beendet, dennoch lief die Kamera weiter. In dieser Zeit fiel der von Ruefer geäusserte Satz.
«Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer.»
Der Kontext
Unter den Geladenen befinden sich Journalist*innen verschiedener Medienhäuser, die sich nach der Presseversammlung grösstenteils einig zu sein scheinen: Ruefer ist kein Rassist. Der Tagesanzeiger schreibt hierzu, der Satz deute darauf hin, «wie Xhaka als Führungsfigur funktioniert. Und diese Art ist für Ruefer eben nicht klischeehaft schweizerisch, also eher zurückhaltend, sondern forsch, mit klar formulierten und sehr hohen Zielen.»
Die vermeintlich positive Umschreibung Xhakas scheint hier ein Ausschlusskriterium für Rassismus zu sein, ausserdem stelle Ruefer zu keiner Zeit einen «Zusammenhang mit der Herkunfts- oder Nationalitätenfrage» her, das Gegenteil sei der Fall: «Ruefer sagt mehrmals, wie froh er sei, dass seit einiger Zeit nicht mehr über die Herkunft der Nationalspieler debattiert werde, diese Diskussion habe er nie verstanden», steht im Tagesanzeiger.
«Ruefer sagt mehrmals, wie froh er sei, dass seit einiger Zeit nicht mehr über die Herkunft der Nationalspieler debattiert werde.»
Dass die öffentliche Diskussion um die Herkunft der Schweizer Nati-Spieler der Vergangenheit angehöre, ist zynisch, zumal wir ja gerade in diesem Moment wieder über die Herkunft eines Nati-Spielers diskutieren – mit einer Steilvorlage von Ruefer selbst. Anstatt die Aussage als Indiz für Ruefers «nicht-rassistische Absicht» zu nehmen, sollte sie in der Berichterstattung kritisiert, hinterfragt und eingeordnet werden.
Wer entscheidet, was rassistisch ist?
Dass dies nicht geschieht, steht sinnbildlich dafür, wie die Debatte um Rassismus in der Schweiz geführt wird – einseitig, oberflächlich und fahrlässig. In Redaktionen, in denen rassifizierte Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich unterrepräsentiert sind, entscheiden von Rassismus nicht betroffene Redaktor*innen darüber, ob und wann etwas rassistisch ist.
Dabei wird die Diskussion um Rassismus als lästig und mühsam empfunden, eine Debatte, die von Gutmenschen, Linksradikalen oder übersensiblen Ausländern befeuert wird. Es war nicht so gemeint, also hört auf beleidigt zu sein. Wo kämen wir denn auch hin, wenn der Star-Kommentator der Länderspiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rassistische Aussagen von sich geben würde? Und was nicht sein darf, ist nicht.
Deshalb sind sich der Rechtsdienst des SRF, die Vorgesetzten von Sascha Ruefer, sowie «ein externer Experte» einig, «dass in der gesamten Aufnahme keine einzige Aussage des Reporters rassistische Züge trägt», was der Tagesanzeiger-Redaktor Ueli Kägi mit «dieses Fazit scheint berechtigt» quittiert.
Xhaka kann vieles sein, aber einer von uns ist er nicht.
Es ist eine Schlussfolgerung, die infrage gestellt werden muss. Die Aussage «Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer» impliziert, dass Fähigkeiten, Potentiale und Charaktereigenschaften von Menschen angeblich auf körperliche und kulturelle Merkmale zurückzuführen sind. Xhaka kann vieles sein – aber einer von uns ist er nicht. Ob seiner Herkunft oder (wie Sascha Ruefer es nun darzustellen versucht) seines Charakters wegen ist dabei nicht einmal zentral. Denn egal ob Herkunft oder Charakter – gemäss Ruefer gibt es anscheinend Dinge, die ein gewisses «Schweizertum» auszeichnen. Und damit gehen stets auch Privilegien einher, die exklusiv sind, und die nicht allen gewährt werden können. Damit steht Ruefer nicht allein. So funktioniert unsere Gesellschaft, und so ist auch unsere Politik aufgebaut – nicht umsonst hat die Schweiz eines der restriktivsten Einbürgerungsgesetze der Welt.
«Vieles, aber kein Schweizer» – damit spricht Ruefer aus, was Generationen von Menschen seit Jahrzehnten tagtäglich zu spüren bekommen – sei es beim Schulübertritt oder bei der Stellen- oder Wohnungssuche, um nur eine grobe Aufzählung struktureller Diskriminierung zu machen. Und er lacht damit all jenen ins Gesicht, die trotz heftigen Gegenwindes versuchen, sich mit der Schweiz zu identifizieren, obwohl ihnen das Schweizer*in-Sein aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres Namens bereits im Kindergarten abgesprochen, und in Medienberichten oder politischen Debatten regelmässig infrage gestellt wird.
Ruefer betreibt mit seiner Aussage «Othering» und nährt damit eine rassistische Ideologie, auch wenn sie im Mantel eines Komplimentes («Führungsqualitäten», «hohe Ziele») daherkommt – was sie besonders fies macht. Denn solch vermeintlich positiven Rassismen tragen die Erwartung in sich, man müsse sie weglächeln oder sogar dankbar dafür sein.
«Also doch kein Rassismus!», schreit es selbstgefällig aus den Kommentarspalten.
Damit stösst er nicht nur Xhaka oder Menschen mit kosovarischem Background vor den Kopf, sondern im Prinzip alle, deren Vorfahren nicht beim Rütlischwur mit dabei waren. Dass ein expliziter Bezug zur «Herkunfts- oder Nationalitätenfrage», z.B. im Hinblick auf den Kosovo, gemacht wird, ist hierzu nicht notwendig.
Anstatt in den Zeitungen von einer Dekonstruierung dieser problematischen Aussage zu lesen, werden wir nun Zeug*innen eines allgemeinen Aha-Moments: «Also doch kein Rassismus!», schreit es selbstgefällig aus den Kommentarspalten. Denn in der öffentlichen Debatte scheint der Rassismus-Vorwurf zu schwerwiegend, als dass er tatsächlich berechtigt sein könnte.
Rassismus als individuelles Problem
Rassismus wird als ein Problem anderer wahrgenommen, ein Problem, das ausschliesslich in der rechten Ecke zu verorten ist. Hitler und Nazis sind Rassisten, gute Menschen können keine Rassisten sein. Rassismus wird als etwas rein Individuelles und nicht Strukturelles empfunden. Dass Rassismuserfahrungen für viele Menschen an der Tagesordnung sind, wird gänzlich ausgeblendet. Deshalb wird auch der Vorwurf, eine rassistische Aussage gemacht zu haben, als Zumutung empfunden. Es ist eine Beleidigung, Rassist zu sein, und die Reaktionen darauf sind oft Wut, Abwehr und Empörung.
Diese legt auch Sascha Ruefer in der Pressekonferenz von letztem Freitag an den Tag. Er habe sich gemäss Tagesanzeiger selbst gegoogelt, unter den Suchbegriffen «Ruefer» und «Rassismus» seien mehrere Dutzend Texte erschienen. Er sei als Rassist gebrandmarkt, «was löst das bei meinem neunjährigen Sohn aus?», fragt Ruefer die Journalisten. Deshalb wolle er sich erklären. Er sei «kein Rassist», sagt er, und dann empört er sich darüber, dass jemand seine Aussage rausgegeben hat. Watson zitiert Ruefer wie folgt: «Jemand nahm diese Aussage – ohne jeglichen Kontext – spielte sie einem Journalisten zu mit der klaren Botschaft: Schau, Sascha Ruefer ist ein Rassist. Mir wollte jemand schaden.» Der WoZ, die den Satz publik gemacht hat, droht Ruefer indes mit einer Klage.
«Mir wollte jemand schaden.»
Ruefer hatte mehrere Tage lang Zeit, sich ernsthaft mit dem Rassismus-Vorwurf auseinanderzusetzen. Er hätte die Zeit nutzen können, endlich darüber nachzudenken, inwiefern er mit seinen Kommentaren seit Jahren (!) die Debatte über «echte» und «falsche» Schweizer anheizt. Stattdessen stellt er sich als Opfer einer Verschwörung dar, und ist besorgt um seinen Ruf – eine Reaktion, die nicht ungewöhnlich ist.
Denn mittlerweile gibt es eine ganze Forschung darüber, wie Menschen reagieren, wenn ihnen Rassismus aufgezeigt wird. Tupoka Ogette beschreibt diesen Prozess in ihrem Buch «Exit Racism» folgendermassen: «Einen Rassismusvorwurf zu erhalten, ist immer schlimmer und emotional schwerwiegender als das, was die fragliche Situation oder der fragliche Spruch ausgelöst hat. Immer. Deshalb macht man sich (…) auch viel mehr Sorgen darüber, ‹rassistisch› genannt zu werden, als sich tatsächlich mit Rassismus und dessen Wirkungsweisen zu beschäftigen.»
«Einen Rassismusvorwurf zu erhalten, ist immer schlimmer als das, was der fragliche Spruch ausgelöst hat.»
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff der «White Fragility» (weisse Zerbrechlichkeit), wobei der Ausdruck weiss nicht primär die Hautfarbe beschreibt, sondern eine soziale Kategorie benennt. Mit weiss ist in der Schweiz die Mehrheit der Menschen gemeint, die keinem Rassismus ausgesetzt sind. Zu dieser Abwehrhaltung gehört Tupoka Ogette zufolge auch, dass Personen, die Rassismus benennen, «bestraft und eingeschüchtert» werden. Das Ziel sei es «weisse Solidarität (…) aufrecht zu erhalten – die unausgesprochene Abmachung, dass weisse Privilegien beschützt werden müssen, und man sich nicht gegenseitig in die Verantwortung nimmt, was Rassismus betrifft».
Rassismus in der Berichterstattung
Was Kritiker als Verschwörungstheorie abtun, zeigt sich gerade in der gegenwärtigen Diskussion sehr real: Anstatt sich mit den Dynamiken von Rassismus auseinander zu setzen, wurde der «Kontext», in welchem Ruefers Aussage fiel, in der Berichterstattung grösstenteils unhinterfragt hingenommen. Aufgrund welcher Kriterien der Rechtsdienst des SRF zu der Einschätzung kam, dass «keine einzige Aussage des Reporters (Ruefer) rassistische Züge trägt», wurde ebensowenig behandelt wie die Identität des besagten «externen Experten». Stattdessen widmete sich das Branchenmagazin persoenlich.com lieber der Frage, wie in Interviews verhindert werden kann, dass unliebsame Aussagen geleakt werden.
Die NZZ bringt den gruseligen Begriff «DNA» ins Spiel.
Und nicht nur das: einige Reporter zeigten grossen persönlichen Eifer darin, Ruefers Aussage zu verteidigen. So holt NZZ-Redaktor Benjamin Steffen zu einem regelrechten Plädoyer aus, um vermeintliche Beweise gegen den Rassismus-Vorwurf zu liefern:
«Ruefer hatte nicht gesagt, Xhaka sei ‹kein Schweizer› – sondern: ‹alles, nur nicht Schweizer.› Und er führte gleich darauf weiter aus. Was die DNA angehe; Xhaka ticke völlig anders, eine Führungsperson sei nie wie Granit, aber am Ende übernehme er ja doch die Verantwortung.»
Was wahrscheinlich als Hilfestellung gedacht war, ist eine Verschlimmerung der Debatte, indem Steffen nicht nur die Exklusivität des «Schweizertums» nochmals emporhebt, sondern auch den gruseligen Begriff «DNA» ins Spiel bringt.
«Ich hab den Beat Feuz noch nie gesehen, dass er sich vor dem Lauberhornrennen hat ein Tattoo stechen lassen – das würde dem nie in den Sinn kommen!»
An einer anderen Stelle nimmt der NZZ-Redaktor auf den Artikel der WoZ Bezug, und schreibt: «Aber wer sagt, dass es Ruefer dabei um ‹echte und nicht ganz so echte Schweizer› geht?» Mit eher fadenscheinigen Argumenten versucht er geltend zu machen, der Vergleich Granit Xhakas mit Skirennfahrer Beat Feuz (damals hatte sich Xhaka vor einem Turnier ein Tattoo stechen lassen – Ruefer kommentierte: «Ich hab den Beat Feuz noch nie gesehen, dass er sich vor dem Lauberhornrennen hat ein Tattoo stechen lassen – das würde dem nie in den Sinn kommen!») habe nichts mit Xhakas Herkunft zu tun, sondern könne eine «Frage des Typs sein» oder «des Sportarten-Umfelds, dass sich Fussballer eher mal ein Tattoo stechen lassen als Skirennfahrer». Man könnte hier ebenso die Frisur oder Schuhgrösse aufführen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Alles scheint möglich, nur kein Rassismus.
Die Frage nach der Absicht
Im Zweifelsfalle wird eine rassistische Aussage also in alle Himmelsrichtungen gedreht, bis sie den Absender entlastet. Als Argument wird aufgeführt, wie es gemeint war, und nicht etwa welche Wirkung die Aussage hatte. Hierbei handelt es sich um eine unzumutbare Logik, denn ihr zufolge wären wohl über 90% der sexuellen Übergriffe gar keine Übergriffe, weil die Täter es ja «nicht böse gemeint haben».
Was es braucht, ist ein Bewusstsein darüber, dass wir als Gesellschaft rassistisch sozialisiert sind. Rassistisches Denken ist nicht das Ausnahmeproblem einiger Weniger, es ist die Regel. Wir alle sind Träger*innen rassistischer Bilder und Stereotype, wir alle haben Einstellungen darüber, wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion zu sein haben. Das macht es nicht besser – das Wissen darum bietet jedoch die Chance, sich von der Abwehrhaltung zu lösen, und den Shift von der «Absicht» hin zur «Wirkung» zu machen, um sich konstruktiv mit rassistischem Denken auseinanderzusetzen, mit dem Ziel Rassismus zu bekämpfen.
Das Schweizer Fernsehen fragt baba news immer wieder um die Teilnahme an Podien oder das Halten von Referaten zu rassismuskritischen Themen an. Dabei hätte gerade hier für das SRF die Möglichkeit bestanden, sich klar gegen Rassismus zu positionieren und Fehler einzugestehen. Gerade wenn die öffentliche Debatte so grosse Ausmasse annimmt, ist Rückgrat gefragt, denn bei dieser Geschichte geht es nicht um Sascha Ruefer vs. Granit Xhaka, sondern um die Grundsatzfrage, welchen Stellenwert ein öffentlich-rechtliches Medium seiner migrantischen Klientele zuschreibt, die es zu einem beachtlichen Teil mitfinanziert.
Und auch Ruefer selbst hätte einen anderen Weg einschlagen können. Er hätte seinem neunjährigen Sohn erklären können, dass rassistische Bilder aufgrund unserer Geschichte Teil unserer Gesellschaft sind. Er hätte erklären können, dass wir aber die Wahl haben, uns kritisch damit auseinander zu setzen. Und er hätte seinen Fehler eingestehen und sich einfach entschuldigen können.

ist Gründerin und Chefredaktorin des Online-Magazins baba news.
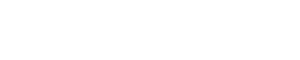
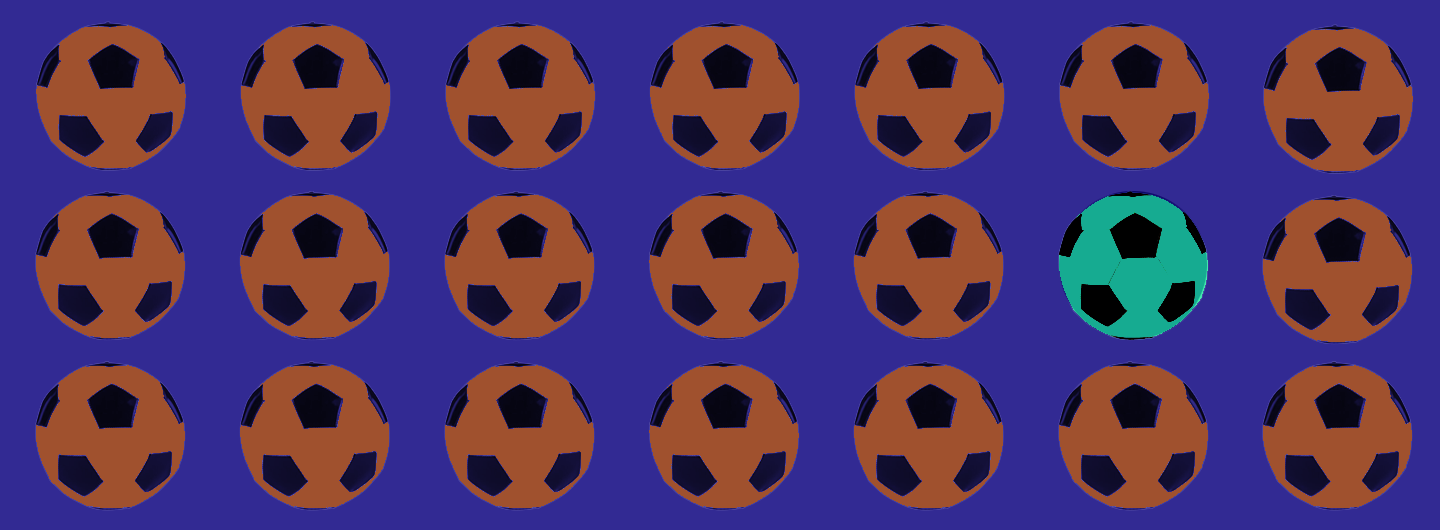
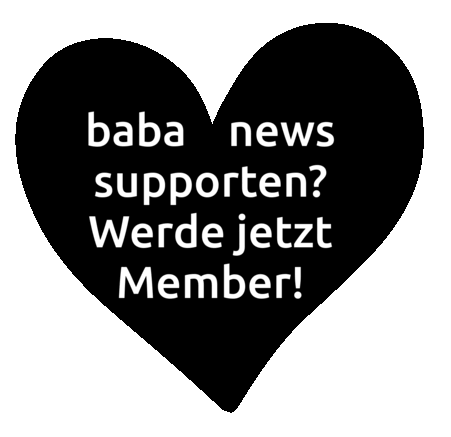
Der Beobachter hat 2019 online einen Artikel über Sie veröffentlicht mit dem Titel “Wir haben was zu sagen”, in dem Sie wie folgt zitiert werden: “Wir schreiben davon, wie es ist, wenn man den eigenen Eltern zu schweizerisch geworden ist.” Wie erklären Sie diese Äusserung vor dem Hintergrund, dass Sie Ruefer aufrund seiner Aussage zu Xhaka Rassismus vorwerfen?
Vielen Dank für diesen Beitrag!
Sehr geehrte Frau Muhtari, sind Sie selber vollständig frei von rassistischen Denkmuster? wenn nicht, finde ich es heikel, den anderen öffentlich zu brandmarken. Mit freundlichen Grüssen, Matthias Umbricht
Ja, denke tatsächlich ein Grundproblem, dass Leute wie Ruefer felsenfest überzeugt sind, nichts mit Rassismus zu tun zu haben — deshalb ja auch seine wohl ehrliche Empörung über den WOZ-Artikel. Ich denke mal, Sascha Ruefer ist einfach kein grösseres Mass an Reflexion zuzutrauen. Enttäuschend und irgendwie erschreckend aber wie Journalisten wie Ueli Kägi vom Tagi nach erst mutigen Voten (wenn SRF den Vorwurf nicht entkräften kann, ist Rueger nicht mehr tragbar) dann nach der PR-Einseifung anlässlich der grossen Kontext-Enthüllung durch SRF (von der auch die WOZ ausgenommen war!) komplett Entwarnung geben und nicht sehen, wie der berühmte Kontext nichts an der Tatsache ändert, dass Ruefer (und alle anderen Rütli-schweizerischen Journalisten rechts der WOZ) im Jahr 2023 nicht gecheckt haben, dass ein Grossteil der Schweizer von heute nicht beim Rütlischwur dabei waren, wie es Albina Muhtari schön formuliert, und dass ein richtiger Schweizer (traditionsgemäss finden die Frauen in dieser Debatte ja nicht statt) einer ist, der über Ruefers bünzlige Eigenschaften verfügt. Mein Nachname kommt aus der Gegend der Rütlisverschwörer, aber ich bin offenbar (so hoffe ich zumindest) nach Ruefers Logik auch alles, aber sicher kein Schweizer. Das ist jetzt in meinem Fall zwar tatsächlich nicht rassistisch, aber es entlarvt, wie unreflektiert, engstirnig und überholt diese Denkweise ist.
Danke für diesen Aufschlussreichen Artikel, so wie Sie das geschrieben haben habe ich das noch nirgends gelesen.
Ich stimme Ihnen völlig zu, dass viele gedankelos geäusserte Worte oder Sätze zumindest für Irritationen sorgen.
Vielen Dank für diesen Text. Er vermittelt mir einen anderen Zugang zum Thema, mit dem ich mich auch befasst habe. Und ich lerne dazu.
Neben dem Lob kommt aber auch Kritik, Albina. Du nimmst für deinen Text in Anspruch, Kontext herzustellen. (Was ich nicht abstreite.) Sascha Ruefer, der dasselbe aus seiner Warte macht, stellt «Kontext» her. Die SRF-Sportredaktion hat für die Beurteilung des gesamten Interviews einen externen Experten beigezogen. Wer das ist, wissen wir nicht, es spielt auch keine Rolle. Weil seine Expertise sich nicht mit deiner deckt, ist er ein «externer Experte».
Mit anderen Worten: Was Ruefer und der externe Experte finden, ist aus deiner Sicht minderwertig.
Ich bin Gastautor des Beitrags bei «Persönlich», der in diesem Artikel erwähnt und verlinkt wird. Mein Fokus zum Thema (Krisenkommunikation, Interview-Setting, medienethische Fragen) wird in deinem Text herabgewürdigt. Du findest diese Aspekte weniger wichtig. Damit kann ich leben, bloss hilft es dem übergeordneten Anliegen nicht.
«Persönlich» ist übrigens das Online-Portal der Kommunikationsbranche, mein Fokus war von der Redaktion so gewünscht. Zu Migration und Rassismus publiziere ich nicht, weil ich davon zu wenig verstehe.
spitzeklasse artikel.
Wirklich ernstgemeinte Frage: Gibt es also keine Dinge, die ein Schweizertum auszeichnen? Ist es nicht so, dass die Existenz von Nationalstaaten, deren geografischen Gegebenheiten, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, historische Ereignisse, Geschichten und Lieder, die mensch über Generationen weitergeben zu unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen führen und diese auch in unterschiedlichen charakterlichen Ausprägungen und Werthaltungen aka. Sozialiserungen erscheinen, welche sich natürlich in einer postmodernen, hochausdifferenzierten und individualisierten Gesellschaft auf extrem unterschiedliche Art und Weise manifestieren ? Damit will ich nur sagen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, auch wenn man dies heute scheinbar kaum noch sagen darf, ohne gleich gecancelt zu werden. Ist die Problematik nicht viel eher in der Hierarchisierung der jeweiligen Kulturen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat und den damit einhergehenden Machtstrukturen und Diskriminierungen zu suchen ?
Hervorragend — danke! 💖
Fundiert erläutert und sehr zutreffend, danke!