Während Israel seit über einem Jahr einen Genozid in Gaza verübt, wird im Kunsthaus Zürich Geld für ein israelisches Museum gesammelt, das geplünderte Artefakte aus Palästina ausstellt und israelische Soldat*innen unterstützt. Eine Recherche.
Elegante Kleider, feines Essen, teure Kunst und exklusive Live-Musik: So sah Ende November eine im Kunsthaus Zürich abgehaltene Spendengala wohlhabender Unterstützer*innen des Israel Museums aus. Dazu eingeladen hatten die «Schweizer Freunde des Israel Museums». Für einen Eintrittspreis von 600 Franken gab es ein Dinner, eine Kunstauktion und eine Performance der diesjährigen israelischen Eurovision Sängerin Eden Golan.
baba news war vor Ort, durfte allerdings nur an der Performance der Eurovision-Sängerin teilnehmen. Aus dem Vorraum aus war im Vorhinein dennoch zu hören, wie die Preise während der Kunstauktion in die Höhe schnellten: Bis zu 10’000 Franken tief griffen die Besucher*innen in die Taschen, um Kunstwerke zu ergattern, die von verschiedenen Personen und Organisationen an die Event-Veranstalter gespendet worden waren.
Nach der Auktion trat dann schliesslich Eden Golan in einem silbernen Kleid vor die rund 150 Gäste. Während ihrer rund 20-minütigen Performance hielt die diesjährige Eurovision-Sängerin eine Rede, in der sie von den «armen Kindern in Israel» sprach, die «ihre Kindheit nicht geniessen» konnten, weil sie sich in Bunkern verstecken müssten. Den mehr als 13’000 durch Israel getöteten Kindern aus Gaza widmete die Sängerin kein Wort. Presse-Interviews wurden nicht zugelassen – die Sängerin verschwand nach einem raschen Selfie mit Fans in den Backstage-Bereich.
Sponsor*innen: EDU-Präsident und Ringier-Verleger
Als Sponsor*innen des Events werden auf einem Flyer, der an der Veranstaltung auslag, der Präsident der Aargauer EDU, Roland Haldimann, sowie verschiedene Kunstunternehmen und das Marriott Hotel Zürich aufgezählt. Der Event wurde weiter von der Ellen & Michael Ringier Stiftung gesponsert – den Ringier-Verlegern gehören der Blick, die Handelszeitung, die Schweizer Illustrierte, Bilanz, NRJ, Glückspost, Beobachter und zahlreiche weitere Medien.

Auch ein Ringier-Journalist nahm an dem Event teil. Blick-Bundeshausredaktor Raphael Rauch liess es sich mit Speis und Trank gut gehen und tanzte applaudierend zur Performance der israelischen Sängerin. Am Tag darauf veröffentlichte Rauch dann einen Artikel, in dem er schrieb, dass die Sängerin während ihres Auftritts «brillierte».
Aktivist*innen kritisieren Golan-Auftritt und Raubkunst im Israel Museum
Doch nicht alle waren so begeistert von der Gala: Vor dem Eingang des Events übten Aktivist*innen eine Farbattacke aus. Eine Person übergoss sich mit roter Farbe und legte Bilder des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu auf den Boden, auf denen «Faschist» stand. In Rauchs Blick-Artikel wird die Farbattacke als «antisemitisch» abgetan. Die Aktivist*innen selbst veröffentlichten derweil einen Instagram-Post, worin sie die «Festnahme der Soldatin Eden Golan» fordern.
Golan ist zwar keine Soldatin, befürwortet das israelische Militär aber öffentlich. Die 21-Jährige wurde aus medizinischen Gründen vom Militärdienst befreit, kündigte allerdings erst vor wenigen Wochen an, sie würde sich dennoch für den Freiwilligendienst anmelden. Gegenüber der israelischen Zeitung «Ynet» geben Quellen aus Golans Umfeld an, es sei «wichtig für sie, sich freiwillig für die Soldat*innen zu engagieren». Geplant sei zudem, dass Golan «an einer weltweiten Public-Diplomacy-Kampagne teilnehmen und ihren Freiwilligendienst beginnen wird, sobald die Kampagne abgeschlossen ist». Zu der «Diplomatie-Kampagne» gehören offenbar auch Auftritte vor internationalen Botschafter*innen, denn im Oktober trat Golan vor den Vereinten Nationen im Namen Israels auf.
Die Aktivist*innen, die vor dem Zürcher Kunsthaus die Farbattacke verübten, waren aber nicht die Einzigen, die die Gala kritisierten. baba news sprach vor dem Event am Bellevue mit anderen Aktivist*innen, die dort Flyer bezüglich der Gala verteilten. Auch sie hielten den Golan-Auftritt für problematisch. Zudem kritisieren sie, dass Räumlichkeiten für palästinasolidarische Events nur schwer zu bekommen seien, während eine «reiche Elite» problemlos das Kunsthaus bekäme.
Israel Museum stellt geraubte Kunst aus Gaza und der Westbank aus
In dem Flyer wird weiter kritisiert, dass sich das Kunsthaus durch die Gala an der «Finanzierung von Raubkunst» beteilige: «Dies geschieht genau jetzt, nachdem die israelische Besatzung wertvolle Artefakte in grosser Zahl aus Gaza gestohlen hat – bevor sie die dortigen Museen zerstörte.»
Amer Shomali, Direktor vom Palästina Museum in Al Birzeit, Westjordanland, bestätigt diese Vorwürfe gegenüber baba news. «Die Sammlung von Moshe Dayan ist ein gutes Beispiel für die geplünderten Werke, die das Israel Museum beherbergt», sagt er auf Anfrage.
Dayan war in den 1960er und 70er Jahren israelischer Verteidigungsminister, und soll diese Position genutzt haben, um Artefakte im Westjordanland und im Gazastreifen zu rauben. Nach seinem Tod kaufte das Israel Museum Dayans Sammlung für rund eine Million Dollar von seiner Witwe ab. «Das Museum weiss ganz genau, dass diese Werke geraubt wurden, was nach internationalem Recht illegal ist», betont Shomali. «Trotzdem sind diese Werke bis heute im Israel Museum ausgestellt.»
Irreführende Deklaration
Zu den bedeutendsten Artefakten der Dayan-Sammlung gehören Särge, die über 3000 Jahre alt sind, und aus Deir al Balah im Gazastreifen stammen. «Nach dem Krieg von 1967 plünderte Dayan diese sogenannten Anthropodien, die sehr wertvoll sind, und aus der späten Bronzezeit stammen», erklärt Shomali.
Den Besucher*innen des Museums werde die Herkunft der Werke aber nicht richtig vermittelt. Denn bei den Artefakten aus Gaza sei der Ursprung laut Shomali lediglich als «östlich der Sinai» angeschrieben. «Geografisch gesehen stimmt das schon, die Fundstätte liegt östlich der Sinai. Aber sie hat einen Namen, und zwar Deir Al-Balah. Die Museumsbetreiber weigern sich allerdings, Gaza oder Palästina als Fundstätten zu nennen, und versuchen stattdessen, die Bildunterschriften so zu manipulieren, dass sie das Wort Palästina umgehen können.»
Neues Gesetz legitimiert Raub
Die Situation im Hinblick auf geraubte Werke hat sich gemäss Shomali bis heute nicht gebessert – im Gegenteil. «Im vergangenen Monat hat die israelische Regierung ein neues Gesetz erlassen, das es den Israelis erlaubt, im Westjordanland Artefakte auszugraben», sagt der Museumsdirektor. Gleichzeitig gibt es Berichte aus Gaza, dass während des gegenwärtigen Genozids Artefakte gestohlen wurden.
Ende Januar veröffentlichte der israelische Direktor der Altertumsbehörde auf seinem Instagram-Account Posts, in denen er erklärte, sein Stellvertreter sei nach Gaza geflogen worden, um dort Antiquitäten zu begutachten. Diese wiederum sollen Berichten zufolge in der Knesset – dem israelischen Parlament – ausgestellt worden sein. Das bestätigte der Direktor auch selbst in einem seiner Posts, worin er schrieb: «Eine kleine Vitrine wurde in der Knesset aufgestellt.»
Als Kritik laut wurde, löschte der Direktor die Posts. Die Behörde veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme: «Die Altertumsbehörde wurde von der israelischen Armee beauftragt, ein Lagerhaus in Gaza zu inspizieren, das antike oder vermutlich antike Gegenstände enthielt. Ein Archäologe führte eine vorläufige Untersuchung durch und die Ergebnisse werden später der israelischen Armee übergeben. Die Gegenstände wurden an ihrem Platz belassen.» Dies steht offensichtlich im Widerspruch zu der vorherigen Aussage, dass einige der Artefakte in der Knesset ausgestellt worden waren.
«Israel will mehr plündern»
Das Entfernen archäologischer Funde aus besetzten Gebieten stellt eine Plünderung von Kulturgütern dar, und verstösst gegen internationales Recht, wie etwa in der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut in Kriegszeiten festgehalten wurde. Auch Israel hat die Konvention unterschrieben. Für Shomali ist dennoch klar: «Israel will mehr plündern und zeigt keinen Willen, Artefakte zurückzugeben. Wir sind also noch weit davon entfernt, unsere Antiquitäten zurückzufordern, sondern befinden uns noch immer in der Phase, in der wir Israel dazu auffordern müssen, mit dem gegenwärtigen Plündern aufzuhören. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, bevor wir unsere Artefakte zurückbekommen.»
Der palästinensische Archäologe und ehemalige Direktor des Palästina Museums, Mahmoud Hawari, betont gegenüber baba news ebenso, dass «Tausende Antiquitäten» illegal erworben und bis heute «in den archäologischen Galerien sowie Gärten des Israel Museums ausgestellt» werden. Für problematisch hält er insbesondere auch die Geschichte, die im Museum durch die Artefakte erzählt würde: «Die Geschichte des Landes Israel statt Palästinas, und die Geschichte des Judentums statt des palästinensischen Volkes, welches über Jahrtausende in dem Gebiet lebte.» Einige der Artefakte reichen zudem bis weit vor die Zeit des Judentums zurück.
Israel Museum unterstützt Soldat*innen nach Gaza-Einsatz
Problematisch ist das Israel Museum nicht nur im Hinblick auf Raubkunst. Wie baba news erfahren hat, arbeitet das Museum auch aktiv mit Soldat*innen zusammen, die am gegenwärtigen Genozid in Gaza beteiligt waren. Im Event-Flyer heisst es in einer Nachricht der Museumsdirektoren: «Vom ersten Tag des Krieges (…) begannen unsere engagierten Mitarbeitenden damit, vertriebene Kinder und ihre Familien in Hotels in Jerusalem und im ganzen Land zu erreichen, und den israelischen Bürger*innen und Soldat*innen, die an Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, die heilende Kraft der Kunst näherzubringen.»
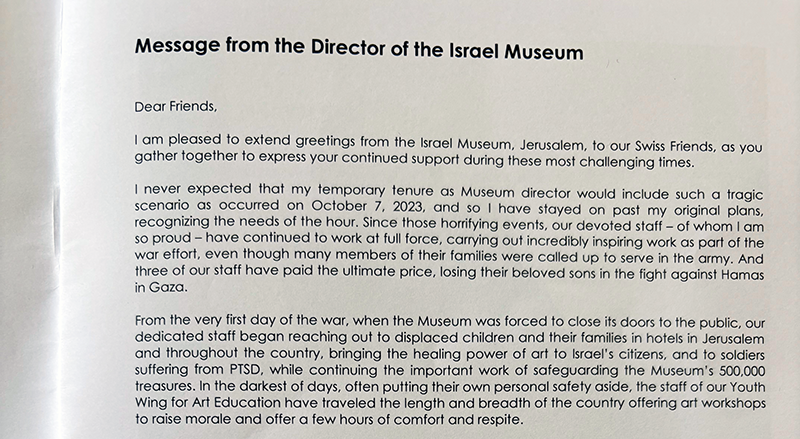
Das Museum scheint das israelische Militär aber auch abseits dieser Programme zu fördern – denn für alle aktiven Soldat*innen ist der Eintritt gratis. Kinder und Senior*innen müssen hingegen zahlen, um das Israel Museum zu besuchen. Das Museum bietet ebenso Ausstellungs-Touren an, die für Soldat*innen gratis sind – gemäss Website mithilfe der «freundlichen Unterstützung der Freunde des Israel-Museums». Ob dazu auch die Schweizer Freunde oder die Besucher*innen der Spendengala gehören, bleibt unklar.
Das Museum selbst geht auf baba news’ Anfrage nicht weiter auf seine Soldat*innen-Programme ein. Ebenso bleibt unklar, wohin genau das in Zürich gesammelte Geld fliessen soll. Das Kunsthaus Zürich sagt auf Anfrage von baba news, das Geld würde gemäss des Mietvertrags «ausschliesslich pädagogischen Zwecken der Kulturvermittlung zugutekommen». Das Israel Museum ignorierte eine entsprechende Anfrage von baba news hingegen. Auch die Schweizer Freunde des Israel Museums hüllen sich in Schweigen.
Einfluss der Regierung unklar
Weitergehend bleibt unklar, wie eng das Museum mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet. Auf der Spendengala erzählte eine Kulturschaffende des Israel Museums baba news, dass Künstler*innen und Kurator*innen alles in ihrer Macht stehende tun würden, um palästinensische Stimmen zu Wort kommen zu lassen. «Aber das Museum ist eine staatliche Einrichtung, und unsere Regierung ist leider faschistisch», so die Kulturschaffende.
Das Museum selbst sagt hingegen – sowie auch das Kunsthaus Zürich und die Schweizer Freunde des Israel Museums –, dass es sich um eine «nichtstaatliche, unabhängige Einrichtung» handeln würde. Zum Bord der Direktor*innen gehört dennoch die Bürgermeisterin von Jerusalem – die wiederum der Likud Partei von Ministerpräsident Netanyahu angehört. Ebenso erhielt das Museum im Jahr 2024 umgerechnet rund fünf Millionen Franken von der israelischen Regierung.
Fest steht hingegen, dass es ethische Fragen aufwirft, eine Spendengala für ein Museum abzuhalten, das geplünderte Werke aus einem Gebiet ausstellt, in dem die Regierung gerade einen Genozid begeht. Ethisch fraglich ist auch, Gelder für ein israelisches Museum zu sammeln, während Israel Berichten zufolge über 200 archäologische und historische Stätten in Gaza angegriffen und zahlreiche Museen zerstört hat. Das Kunsthaus Zürich scheint sich dafür aber wenig zu interessieren. Die Medienstelle betont lediglich, dass «die Vermietung an den privaten Veranstalter sämtliche rechtliche und vertragliche Anforderungen erfüllte.»
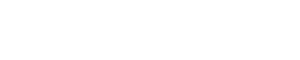

Danke, Melissa, für diese ausführliche Recherche. Ich würde einen solchen Artikel gerne im Tages Anzeiger lesen. Leider bleibt das ein Wunschtraum. Ich hoffe, dass wenigstens die Journalistinnen und Journalisten ihn lesen!
Natürlich ist es traurig, dass Kinder in Israel das Genozid an den Pälästinern miterleben müssen. Für das, was die palästinensischen Kinder erleben, fehlt wohl noch das richtige Wort. Vielleicht hat die Sängerin deshalb nichts gesagt (Ironie off).
Der Zürcher Stadtrat hat der UNRWA einen Beitrag gespendet. Das ist verdienstvoll. Warum lässt er es zu, dass im von der Öffentlichkeit subventionierten Kunsthaus palästinensische Raubkunst präsentiert wird?