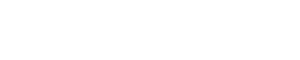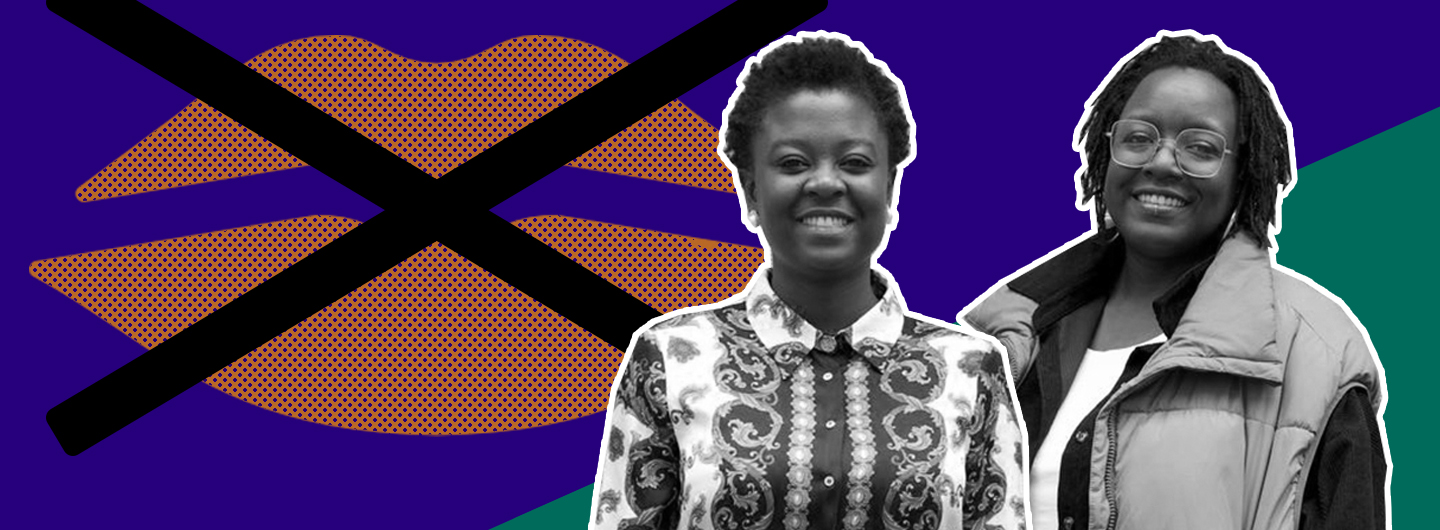Yuvviki Dioh, Diversitätsbeauftrage am Schauspielhaus Zürich, und Critical Race-Theoretikerin Danielle Isler über den Hass, der einem entgegenschlägt, sobald man sich als Schwarze Frau öffentlich exponiert, weshalb «Lauwarm» nicht einmal ein tausendstel Tropfen von kultureller Aneignung ist und was «Allyship» wirklich bedeutet.
Rahel Bains: Sarah Akanji, Hoffnungsträgerin der Zürcher SP, hat vor einigen Wochen angekündigt, bei den Wahlen im kommenden Frühling nicht wieder für den Kantonsrat zu kandidieren. Ein Grund dafür: Rassistische und sexistische Angriffe. Sie sei in Mails, Briefen und Online-Kommentaren wiederholt diffamiert worden. Dabei sei es nicht um ihre politische Arbeit, sondern um ihre Person gegangen. Hat euch diese News damals überrascht?
Yuvviki Dioh: Nein. Aber trotzdem ist es eine Enttäuschung. Weil: Schon wieder ist so etwas passiert. Schon wieder war die Situation für eine PoC (People of Color, im Singular Person of Color), in diesem Fall eine Schwarze Frau in einer wichtigen Position mit einer wichtigen Stimme, offenbar so schlimm, dass sie sagen musste: Aus Selbstschutz muss ich da raus. Vielen ist nicht bewusst, in was für Situationen man sich als PoC oder anders marginalisierte Person in weiss und cis-männlich* dominierten Institutionen begibt. Es ist kein geschützter Raum, in der Politik noch viel weniger als an anderen Orten.
Danielle Isler: Als ich davon hörte, dachte ich: Das Ziel der Rechtsextremen ist erreicht. Sie wollen nicht, dass wir mitreden und haben uns zum Schweigen gebracht. Vor ein paar Jahren war ich Teil eines Forschungsprojektes zum Thema «Hate Speech» an der Universität Zürich. Eine Erkenntnis war, dass so lange Hass gesät wird, bis es der jeweiligen Person zu viel wird und sie schweigt. Personen, die an die Öffentlichkeit möchten, werden dadurch abgeschreckt und haben Respekt davor, es überhaupt erst zu versuchen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die grosse schweigende Masse – ich spreche von denjenigen, die sich niemals als Nazis bezeichnen würden – indirekt auch mitverantwortlich für diese Situation ist. Weil diese Masse schweigt, sind sämtliche Aktivist:innen, insbesondere BIPoC**-Aktivist:innen, die in der Öffentlichkeit stehen, regelmässig Hassreden ausgesetzt.
«Im besten Fall war es Kritik, ansonsten Ablehnung und Hass.»
Yuvviki Dioh: Kurz nachdem ich Anfang 2021 dem «Beobachter» ein Interview gegeben hatte, erzählte mir die Journalistin, dass sie davor selten so viele Online-Kommentare auf einen Artikel erhalten habe. Ein Grossteil des Inhalts war Hass. Ein anderes Mal wurde im «Sonntagsblick» ein Interview mit mir publiziert. Mir wurde von einer Freundin geraten: «Wenn der Artikel rausgeht, schaust du deine Mails drei Tage lang nicht an und gibst deinen Account einer anderen, nicht von Rassismus betroffenen Person, in Obhut». Und tatsächlich: Die Mails fluteten rein. Im besten Fall war es Kritik, ansonsten Ablehnung und Hass. Und das nur, weil ich einmal in den Medien präsent war. Ich will mir gar nicht ausmalen, was es heisst, in der Politik aktiv zu sein. Und dann gibt es wie gesagt diese grosse Masse von Menschen, die still sind und das Fundament am Leben erhalten, auf das die Rechten aufspringen können.
Welche Gedanken gehen euch durch den Kopf, bevor ihr euch in der Öffentlichkeit exponiert?
Danielle Isler: Ich brauchte relativ lange, bis ich den Mut hatte, mich zu exponieren. Der Hass, die Trolle, die Drohungen, denen insbesondere BIPoC-Aktivist:innen in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, schreckten mich ab. Ich entschied mich jedoch irgendwann dazu, laut zu werden, Dinge anzusprechen, um auch die «Silent Mass» auf meine Seite zu ziehen, damit auch sie zu sprechen beginnen. Bei diesem Prozess haben mir die Worte der US-amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde sehr geholfen: «And when we speak we are afraid our words will not be heard nor welcomed but when we are silent we are still afraid. So it is better to speak remembering we were never meant to survive».
Yuvviki Dioh: Ich setze mich derzeit auch mit diesen Fragen auseinander. Was passiert, wenn dein Name geläufig wird, du fast schon eine Art öffentliche Person wirst? Muss ich nun meinen Namen vom Briefkasten und der Klingel meiner Wohngemeinschaft entfernen, weil bei uns auch ein Kind lebt? Und es also nicht mehr nur um meine Sicherheit geht, sondern auch um die der Leute um mich herum?
Nicht nur Sarah Akanjis Geschichte hat für Wirbel gesorgt, sondern auch die vielen Vorfälle und Diskussionen rund um kulturelle Aneignung, Stichwort «Lauwarm», «Das Gleis». Plötzlich hatten alle eine Meinung zur Thematik. Wie hat die Debatte auf euch gewirkt?
Danielle Isler: Kulturelle Aneignung ist nicht «Lauwarm». Nicht mal ein tausendstel Tropfen davon.
Yuvviki Dioh: Der Begriff «Kulturelle Aneignung» ist so viel grösser, genauso gross wie der Begriff Kultur an sich. Wir können nicht alles an «Lauwarm» durchdeklinieren, sondern müssen verstehen, was der Begriff bedeutet. Lasst uns über Macht sprechen und Hierarchie-Systeme. Und Fragen wie: Wer profitiert davon und wer nicht? Wer wird ausgegrenzt und wer nicht? Über den Fakt, dass weisse Menschen mit Locks als «cool» und «weltoffen» angesehen und meine Haare dafür schnell mal mit «ungepflegt» in Verbindung gebracht werden. «Lauwarm» ist ein Beispiel dafür, wie wir mit materieller Kultur und geistigem Eigentum umgehen. Und mit den Fragen, was für historische Hierarchisierungen und Machtdynamiken hinter unseren materiellen Kulturen stehen, wer darauf zugreifen kann und warum. Aber: Ich gehe nur in diese Debatte rein, wenn wir auch darüber sprechen, wie wir den Begriff von kulturellem Austausch abgrenzen. Letzteres passiert sowieso. Ich habe oft erlebt, wie kulturelle Aneignung aus einem Kulturessentialismus und einem Verständnis von Kultur als etwas Statisches diskutiert wurde. Doch das stimmt nicht.
«Was mich an der Cultural Appropriation-Debatte stört, ist, dass sie von Menschen geführt wird, die mit einer Selbstverständlichkeit leben, die wir so noch nie hatten.»
Danielle: Ich forsche zur Konstruktion von rassifizierten und exkludierenden Räumen, insbesondere von «geweissten» Räumen. Mich interessiert, wie «Whiteness» konstruiert wird, wie Exklusion im Raum entsteht. Woher weiss beispielsweise eine BIPoC, dass sie in einem bestimmten sozialen Raum nicht willkommen ist? Es steht ja nicht «Whites only», aber trotzdem spürt sie, dass dieser bestimmte Raum sie nicht willkommen heisst. Dies hängt unter anderem mit Erinnerungen und Trauma zusammen. BIPoC können diese Exklusionen fühlen, die schwierig zu beschreiben und oft schwer nachvollziehbar sind für Menschen, die nicht in einer solchen Haut stecken.
Was sind denn die Eigenschaften dieser sogenannten «Whiteness»?
Unter anderem «White Ignorance» und «White Innocence». Eigenschaften, welche die Weisse Vorherrschaft, auch «White Supremacy» genannt, aufrechterhalten. Wir sind übrigens längst nicht die ersten, die zu Cultural Appropriation, Exklusionen und Teilhabe von BIPoC forschen oder sprechen. Der US-amerikanische Historiker, Soziologe, Philosoph und Journalist W.E.B. Du Bois hat vor fast 120 Jahren sein Werk «The Souls of Black Folk» veröffentlicht. Darin geht es um das Erbe des Rassismus und seine schädlichen Auswirkungen auf das Leben der Schwarzen Menschen – mit anderen Worten geht es darum, wie Formen von «Whiteness», hier im US-Kontext, sich auf Schwarze Menschen auswirken. Der US-Amerikaner Ralph Ellison spricht in seinem Werk «Invisible Man» über die Unsichtbarkeit von Schwarzen Menschen und das performative Unsichtbarmachen von Seiten weisser Menschen. Hierbei geht es auch um das beabsichtigte Ignorieren von Schwarzen Menschen und deren Anliegen.
«Versteht ihr, dass ihr die Strukturen mitgestaltet, ob ihr wollt oder nicht? Ob ihr es böse meint – oder nicht.»
Hast du im Kontext der aktuellen Debatte rund um kulturelle Aneignung auch solche Muster erkannt?
Danielle Isler: Ja, es wurden Stimmen von Schwarzen Menschen bewusst und performativ ignoriert, die Geschichte, die hinter der Praxis von kultureller Aneignung liegt und der Schaden, der bei Betroffenen aus dieser Praxis in der Vergangenheit entstanden ist und immer noch besteht, war bewusst nicht Fokus der Diskussion. «White Innocence» konnte bei dieser Diskussion auch beobachtet werden, in der Form von Aussagen wie «Das ist doch eine süsse Band. Die haben doch nichts Falsches gemacht.» Daraus resultierte auch die Anspruchshaltung: «Wieso darf ich das und jenes nicht sagen – und BIPoC dürfen das?»
Yuvviki Dioh: «Ich meine es ja nicht böse» ist ein Spruch, der in diesem Zusammenhang oft fällt. Dahinter steht ein Unvermögen, sich als Subjekt in Bezug auf diese Welt zu stellen. Doch versteht ihr, dass ihr die Strukturen mitgestaltet, ob ihr wollt oder nicht? Ob ihr es böse meint – oder nicht. Was mich an der Cultural Appropriation-Debatte stört, ist, dass sie von Menschen geführt wird, die mit einer Selbstverständlichkeit leben, die wir so noch nie hatten. Ich kann mich nicht so frei bewegen in dieser Welt. Einmal fuhr ich zum Beispiel für eine Tagung nach Leipzig. Vor meiner Anreise fragte ich meine Freund:innen vor Ort, ob es dort für mich sicher sei. Sie sagten mir: «In der Innenstadt ist es nicht problematisch. Aber du verlässt Leipzig nicht. Da draussen ist Chemnitz und alles, was damit zusammenhängt.» Oder: Viele meiner weissen Freund:innen schwärmen von Italien. Ich muss mir aufgrund des politischen Klimas aber teilweise gut überlegen, in dieses Land zu gehen.
Danielle Isler: Auch in der Schweiz überlege ich mir jeweils gut, wo ich hingehe. Als ich im Rahmen meines Bachelorstudiums Landsgemeinden untersucht hatte, fuhr ich ins Appenzell, wo sie mich beim Bratwurststand wie ein Insekt beäugt und spüren lassen haben, dass ich nicht willkommen bin.
Würdet ihr solche Reaktionen als sogenannte Mikroaggressionen bezeichnen?
Danielle Isler: Oft spricht man von Mikroaggressionen, dabei sind es eigentlich Makroaggressionen. Mit Makro meine ich hier, dass sie Makro, also grössere Auswirkungen haben können. So erinnere ich mich noch heute an ein Erlebnis, das nicht mehr als 30 Sekunden gedauert hat. Beispielsweise kam ein Weisser Mann in mein Zugabteil und wollte sich hinsetzen – bis er mich sah und wieder aufstand. Dann ging er ins Abteil nebenan, wo ebenfalls eine Schwarze Person sass, stand wieder auf und rief: «Alles Schwarz hier drin. Alles Schwarz», dann ging er weiter. Dieser Zwischenfall berührt mich noch heute.
Yuvviki Dioh: Im Übrigen finde ich, dass Mikroaggressionen nicht weniger ernst und problematisch sind als Makroaggressionen.
Danielle Isler: Sie können dein Leben beeinflussen. Weil du Ängste entwickelst und zum Beispiel gewisse Orte meidest oder an bestimmten Anlässen nicht mehr teilnehmen möchtest.
«Könnte in Anbetracht der Ressourcen, die wir in der Schweiz haben, noch mehr getan werden?»
Neulich hat eine Person in einem Gespräch darauf beharrt, das N–Wort brauchen zu dürfen. Ich war überrascht, weil ich das von dieser Person nicht erwartet hätte…
Danielle Isler: Der «White Liberal» wird nicht deshalb zu einem Ally, also zu einem Verbündeten, weil er oder sie es gut meint. Beispielsweise der Backpacker, der eine PoC- Freundin hat und für wohltätige Zwecke spendet, ist aufgrund dieser Eigenschaften nicht per se unser Freund. Es gut zu meinen heisst nicht, dass man automatisch Ally von marginalisierten Personen ist. Das Problem ist jeweils, dass so manche «White Liberals» überzeugt davon sind, «gut» und «empathisch» zu sein und alles bezüglich Aktivismus zu wissen. Die Realität ist aber, dass sie oft keine Selbstreflexion üben und genau das kann für uns gefährlich werden.
Yuvviki Dioh: Antidiskriminierungsarbeit kann durch solche Situationen auch ambivalent werden: Ich arbeite dann mit Menschen, die im Grundsatz ein Verständnis von Diskriminierung haben aber dann trotzdem eine «Bombe» platzen lassen, wie zum Beispiel in Form von problematischen Begriffen, die sie dann aber nicht so leicht «aufgeben» können. Dann fragst du dich beispielsweise: Warum muss ich jetzt mit dir über das N–Wort sprechen? Da suche ich oft die Balance zwischen «Ich will dich jetzt eigentlich nicht davon überzeugen müssen» und «Aber ich weiss, es braucht solche Gespräche, um Transformation voranzutreiben». Es geht mir auch immer um die Frage, ob ich meinen Prinzipien treu bleiben kann.
Stimmen dich solche «Bomben»-Momente manchmal etwas hoffnungslos?
Yuuviki Dioh: Ich habe die Hoffnung nicht verloren, sonst würde ich meinen Job nicht machen. Das, was man jetzt als Diversitätsarbeit bezeichnet, ist nicht neue Arbeit, wir beginnen sie nun einfach zu institutionalisieren.
Eigentlich könnte man meinen, dass Kulturbetriebe im Vergleich zu anderen Institutionen bereits ziemlich «woke» und aufgeschlossen sein müssten, weil sie ja auch als Spiegel unserer Gesellschaft fungieren sollen. Doch ist das tatsächlich so?
Yuvviki Dioh: Ich beobachte, dass sich viele Institutionen auf den Weg machen, diskriminierungssensible Diversität zu fördern. Aber es ist trotzdem noch immer ein durchstrukturierter, hierarchisierter, weiss dominierter, cis-männlicher Space. Wir müssen uns Fragen stellen wie: Welche Leute sind in den Institutionen inklusive Publikum? Eine sehr zentrale Frage für meine Arbeit allgemein ist: Wie bewege ich mich als eine Schwarze, weiblich gelesene Person, deren Job es ist, sich damit auseinanderzusetzen? Zeit ist dabei ein entscheidender Faktor.
Diversitätsagent:innen gibt es zum Beispiel in deutschen Kunst- und Kulturinstitutionen seit 2018. Im Rahmen des Kulturförderungsfonds «360 Grad» wird dort die Frage gestellt, wie man den demografischen Wandel in Deutschland, sprich den Fakt, dass die Stadtgesellschaften viel diverser sind als eigentlich in den Institutionen gespiegelt, anerkennen kann. Die Arbeit ist also nicht neu, aber die Entwicklungen und Resultate sind nicht linear, sondern in einer Wechselwirkung und abhängig davon, was politisch und «da draussen» passiert. Die Mühlen in diesen Institutionen sind langsam. In den Diversitätsagent:innen-Netzwerken schätzen wir die Dauer der Transformationen von Institutionen auf circa 15 bis 20 Jahre.
Danielle Isler: Klar sind Fortschritte zu erkennen und es ist auch grossartig, dass sich etwas bewegt. Aber die Frage ist: Ist das genug? Könnte in Anbetracht der Ressourcen, die wir in der Schweiz haben, noch mehr getan werden? Ressourcen im Sinne von finanziellen Ressourcen, Wissen, Arbeitskraft und so weiter. Wenn es um die Veränderung der Situation von marginalisierten Gruppen geht, kommt immer mal wieder das Argument: «Die Situation ist ja besser als auch schon. Früher war es viel schlimmer.» Es ist gut und wichtig, Positives zu erkennen und Fortschritte zu preisen. Jedoch können solche Argumente auch dazu führen, dass die Gerechtigkeitsbewegung nicht weiter vorangetrieben wird.
«Ich hoffe, dass ich im Alter nicht müde bin vom lebenslangen Kampf gegen den Rassismus.»
Yuvviki, du hast bereits doktoriert – und du, Danielle, bist gerade dabei. Was habt ihr an den Universitäten für Erfahrungen gemacht?
Yuvviki Dioh: Ich habe meine Dissertation in der Abteilung International Communication Studies zum Thema «Refugee Coverage» in ugandischen, kenianischen, deutschen und französischen Zeitungen geschrieben. Das Unvermögen, mit mir und meiner Arbeit umzugehen, war riesig. So hat man mich zum Beispiel gefragt, ob ich dazu forsche, weil ich aus diesen Ländern stamme. Ich fragte zurück: Ihr forscht ganz selbstverständlich zur UK oder zu Polen – und stammt auch nicht von dort. Auch waren nur wenige Datensätze aus dem globalen Süden vorhanden. Wenn ich beispielsweise Datensätze aus Brasilien betrachtet habe, fragte man mich, ob ich mir wirklich sicher sei, damit universelle Aussagen zu tätigen. Und ich war so: Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ihr nehmt die USA für Thesen und das, obwohl man das auch nicht mit unserer Gesellschaft vergleichen kann.
Danielle Isler: Als Sozialwissenschaftlerin, die zu struktureller Ungleichheit und struktureller Gewalt forscht, werde ich in meiner Doktorarbeit zum Beispiel Johan Galtung, der als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung gilt, zitieren müssen. Ich möchte keineswegs sagen, dass seine Werke, Konzepte und Theorien nicht wegweisend und aussagekräftig sind. Wenn es allerdings um den Inhalt des Begriffs «Structural Violence» geht, der 1969 auf Johan Galtung zurückzuführen ist, gibt es beispielsweise die Afro-Brasilianerin Maria Carolina de Jesus, die circa ein Jahrzehnt zuvor ein ähnliches Konzept veröffentlichte. Sie ist allerdings wenig bekannt und wird dementsprechend auch wenig zitiert. In meiner Doktorarbeit möchte ich besonders darauf achten, auch Autor:innen zu zitieren, die eine kleinere Reichweite haben, in Vergessenheit geraten sind und/oder in den Hintergrund gedrängt wurden.
Ihr müsst euch theoretisch also bewusst anpassen, um Erfolg zu haben?
Danielle Isler: Um als Schwarzer Mensch in geweissten Institutionen voranzukommen, ist es praktisch unumgänglich, sich den geweissten Normen entsprechend zu verhalten. Wir alle haben unterschiedliche Arten, uns in verschiedenen Situationen zu präsentieren. Zum Beispiel verhalten wir uns auf der Arbeit, mit Freund:innen oder mit den Familienmitgliedern, die uns schon unser ganzes Leben lang kennen, anders. Diese Veränderung wird als Code-Switching bezeichnet. Für BIPoC weltweit ist Code-Switching allerdings oft eine Frage des Überlebens – insbesondere in geweissten Räumen.
Zu Beginn dieses Gesprächs ging es darum, die eigenen Grenzen zu spüren. Wie geht es euch diesbezüglich bei eurer Arbeit? Habt ihr noch Kraft dafür oder denkt ihr manchmal auch ans Stillwerden?
Yuvviki Dioh: Ich bin derzeit dabei, herauszufinden, wie der Frust nicht zu gross wird und der Energiehaushalt ausgeglichen bleibt. Ich versuche auch zu lernen, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Ich horche in mich hinein, überlege mir, wann ich was sage und wann nicht. Vor allem bei problematischen Aussagen. Ich frage mich dann: Gebe ich meine Energie in diesen kleinen Moment rein? Oder nehme ich das Wissen, was soeben passiert ist, mit und lade die dafür verantwortliche Person an den nächsten Sensibilisierungskurs am Haus ein, wo wir dann darüber sprechen werden? Ganz grundsätzlich will ich meine Energien nicht für jene verbrauchen, die nicht wollen. Es gibt genug Menschen, die lernen und Teil einer Transformation sein wollen und da kanns schon schwierig genug werden.
«Viele haben oft eine wahnsinnige Angst davor, das Falsche zu sagen.»
Danielle Isler: Bereits als Kind habe ich Bücher gelesen, die von Bürgerrechtsbewegungen handelten. In der Schule hielt ich Vorträge zu Malcolm X, Miriam Makeba und Martin Luther King. Als ich älter wurde, schaltete ich in den Fluchtmodus und beschäftigte mich weniger mit Themen rund um Gerechtigkeit. Im Studium kam meine aktivistische Seite wieder hervor. Seit Jahren befinde ich mich nun in einem sogenannten Kampfmodus. Damit meine ich den Kampf für Gerechtigkeit, «echten» Fortschritt und «echte» Teilhabe. Dieser Weg kann aber auch sehr ermüdend sein. Es gibt Tage, an denen ich nicht hören will, wo auf der Welt eine Schwarze Person aufgrund ihrer Hautfarbe getötet wurde. Oder was für eine neue Arielle-Diskussion angelaufen ist. An solchen Tagen möchte ich für einmal nicht über strukturelle Ungleichheiten sprechen, sondern einfach nur über etwas aus meiner Sicht Belangloses, wie zum Beispiel über Nagellack.
Ein befreundeter, älterer Schwarzer Anti-Apartheid-Aktivist aus Südafrika, der während über zwei Dritteln seines Lebens in Zeiten der Apartheid gelebt hat, meinte einmal zu mir: «Ich war mein ganzes Leben lang ein verbitterter, trauriger Mensch. Meine Kinder haben einen unglücklichen Mann gesehen und nun meine Grosskinder. Wann wird dieses Land zu einem gerechten Ort? Wann werde ich endlich glücklich sein?» Diese Sätze haben mich markiert. Ich hoffe, dass ich im Alter nicht müde bin vom lebenslangen Kampf gegen den Rassismus. Vor allem, wenn sich bis dahin nicht viel geändert hat.
«Allyship ist keine Identität, sondern eine Handlung. Es findet im Moment statt.»
Yuvviki Dioh: Ich will nicht bitter werden. Meine Freundin Leslie Philbert, die im Tanzhaus arbeitet, spricht immer über «Black Joy» und das inspiriert mich. Ich will «joyful» sein, auch in meiner Arbeit. Ich will die Leute um mich herum gerne haben, auch wenn sie manchmal dumme Sachen sagen (lacht). Wir müssen aus diesem Kreislauf von Gewalt und Wut herauskommen.
Wie kann man bei diesem Prozess unterstützen? Wie ist man ein guter Ally?
Yuvviki Dioh: Viele haben oft eine wahnsinnige Angst davor, das Falsche zu sagen. Ich finde dann: Genau dafür ist mein Job da. Du musst weder vor mir noch vor dem Thema Angst haben. Klar wird es unangenehm. Es ist kein harmonischer Wir-haben-uns-alle-gern-Prozess. Es wird hart. Aber es ist gut und richtig. Beginne, Codes und Ästhetiken zu lesen. Setze dich mit Repräsentations-Fragen auseinander. Du musst es für dich kultivieren und immer wieder probieren. Bei Fehlern nicht einknicken, sondern sagen: Scheisse gemacht, aber jetzt weiter. Du darfst in heiklen Momenten nicht defensiv werden, was aber oft aus einem Schamgefühl passiert.
Danielle Isler: Zuhören, Selbstreflexion und Verlernen ist sehr wichtig. Und sich weiterzubilden. Auch ich musste mich einerseits weiterbilden und andererseits Selbstreflexion praktizieren und Dinge verlernen, die ich gelernt hatte. Denn nur weil man zum Beispiel Schwarz ist, wird man nicht per se zu einem Anti-Rassismusexperten oder einer Anti-Rassismusexpertin. Man kann zwar Rassismus erfahren und spüren, aber nicht unbedingt mit einer Theorie verknüpfen und dementsprechend auch nicht gut artikulieren. Weil man es nicht gelernt hat. Genauso müssen weisse Menschen diese Strukturen lernen. Eine beste Freundin zu haben, die Schwarz ist oder bei der Roten Fabrik ein Praktikum gemacht zu haben, führt nicht automatisch dazu, dass man sich seinem «White Privilege» bewusst ist und theoretisches Wissen darüber hat, was BIPoC tagtäglich erleben in dieser strukturell rassistischen Welt. Allyship ist keine Identität, sondern eine Handlung. Es findet im Moment statt. Wenn du zum Beispiel laut Stopp sagst. Ally sein kann auch bedeuten, dass du nach einem rassistischen Vorfall den Raum verlässt.
Yuvviki Dioh: Nutze dein Privileg. Dazu braucht es das Verständnis, wieso du privilegiert bist.
Danielle Isler: In aktivistischen Kreisen heisst es auch: «If it doesn’t cost you anything, then you’re not doing anything». Es muss dich Mut und Überwindung kosten. Auch uns kostet es was.
*Als Cisgender werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität demjenigen Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde .
** Black, Indigenous and People of Color