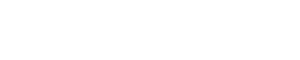Heute ist der internationale Tag der Bildung. Wir sprachen mit Dr. Stefanie Claudine Boulila über Chancengleichheit an Schweizer Schulen. Sie erklärt, wovon Bildungserfolg abhängt, wie Schulen Zugänge verweigern und was sich ändern muss, damit Chancengleichheit herrscht.
In der Schweiz spricht man häufig davon, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben, später das zu werden, was sie sich wünschen – wenn sie nur genug lernen und gute Note schreiben. Was halten Sie von dieser Aussage?
Dieses meritokratische Märchen wird angeführt, um das Bildungssystem, das soziale Ungleichheiten reproduziert, zu verteidigen. Mit solchen Aussagen wird der Fokus verschoben. Weg von den Institutionen, hin zur Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen. Anstatt Institutionen infrage zu stellen, stellt man die Schüler*innen infrage.
Sie sagen, dieses Märchen wird erzählt, um das Bildungssystem zu verteidigen, welches soziale Ungleichheiten reproduziert. Wieso verteidigt man überhaupt ein System, das Ungleichheit reproduziert?
Ich denke, es ist eine Mischung aus Gleichgültigkeit und Überforderung. Aber auch die Angst sich einzugestehen, dass überhaupt ein Problem besteht und man seine Arbeit vielleicht doch nicht so gut macht, wie man meint. Sich einzugestehen, dass etwas nicht funktioniert, würde bedeuten, dass man seinen Glauben an das System grundsätzlichen infrage stellen müsste. Es ist einfacher, marginalisierten Gruppen, die bereits stereotypisiert sind, den Ball zuzuschieben, als sich selbst zu hinterfragen und sich einzugestehen, dass es strukturelle Probleme innerhalb der Institution gibt.
Das heisst also, reine Willenskraft reicht nicht aus, um Erfolg in der Schule zu haben?
Die internationale Forschung zeigt, dass Schulerfolg massgeblich vom Zugang zu materiellen und immateriellen Ressourcen abhängt. Zu den materiellen Ressourcen gehört z.B., dass man genug Geld für eine grosse Wohnung hat, damit alle Kinder genügend Rückzugsorte haben. Immaterielle Ressourcen sind aber genauso wichtig. Hier ist beispielsweise das Bildungskapital der Eltern sehr wichtig. Sie können dann z.B. ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen, oder gegenüber Lehrpersonen und der Schule sicherer auftreten. Haben Eltern einen höheren Bildungshintergrund, werden sie von Lehrpersonen und Schulleitungen ganz anders wahrgenommen und behandelt.
In der Schweiz geht man immer noch davon aus, dass Rassismus ein Problem von Einzelpersonen ist.
Was sind die Ursachen von Vorurteilen gegenüber Schüler*innen?
Rassistisches Wissen zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und macht natürlich auch vor der Schule nicht halt. In der Schweiz geht man immer noch davon aus, dass Rassismus ein Problem von Einzelpersonen ist. Der Strafrechtsparagraf bestärkt den Eindruck, dass Rassismus eine Ausnahme und eine Abweichung von der guten Norm ist und genau hier passiert der Denkfehler. Durch die europäische Kolonialgeschichte und Nationalstaatenbildung haben Rassismus und Xenophobie die Schweiz nachhaltig geprägt. Rassistisches und xenophobes Wissen, in der Form von Annahmen über bestimmte Menschen, ist in jedem Bereich unserer Gesellschaft anzutreffen und dieses Wissen kann auch von Menschen, die sich nicht als rassistisch verstehen, reproduziert werden. Gerade weil Rassismus und auch Xenophobie keine Ausnahme darstellen, ist es zwingend für die Chancengleichheit, dass sich Schulen sowie pädagogische Hochschulen der Thematik annehmen.
Können Sie ein Beispiel nennen, wie Lehrkräfte unbewusst Rassismus reproduzieren können?
Zum Beispiel indem sie Kindern mit Migrationsgeschichte weniger zutrauen und tiefere Erwartungen an sie haben. Der schulische Erfolg wird ihnen nicht zugetraut oder sie werden schlechter eingestuft. Wenn sie zum Beispiel eine andere Muttersprache sprechen, wird diese nicht als Ressource, sondern als Defizit wahrgenommen.
Viele von uns haben Lehrer*innen den Satz sagen gehört: Es ist besser, ein guter Realschüler zu sein als ein schlechter Sekundarschüler. Was halten Sie von diesem Satz?
Dieser Satz zeigt die Normalisierung von tiefen Erwartungen, welche man gegenüber Schüler*innen mit Migrationsgeschichte hat. Es ist ein gewaltvoller Akt des Gatekeepings.
Gatekeepings?
Das ist, wenn man aktiv versucht zu kontrollieren, wer wo eingestuft wird, und somit bewusst versucht, den Zugang zu verweigern. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Schulen merken, dass Schüler*innen aus bestimmten sozialen Gruppen in einer bestimmten Schulstufe unter- oder übervertreten sind, sie das als Beweis für bestimmte Stereotypen nehmen und nicht als Indikation, dass die Institution es nicht schafft, Ungleichheiten auszugleichen.
Die Schweizer Volksschulen werden als Ort für alle idealisiert. Würde man jetzt sagen, wir haben ein Problem, würde das dieses ideologische Konstrukt ins Wanken bringen.
In zahlreichen Interviews erzählen uns unsere Protagonist*innen regelmässig von Diskriminierungserfahrungen in der Schule. Gleichzeitig entsteht oft der Eindruck, dass Schulen diese Wahrnehmung nicht teilen. Viele Schulleitungen scheinen davon auszugehen, dass Vorurteile und Rassismus an ihren Schulen kein Problem seien. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Dass das Wort Rassismus im Lehrplan 21 nicht einmal vorkommt, ist eine Illustration des Problems. Es zeigt, dass Rassismus in der Imagination von z.B. Bildungspolitiker*innen nicht existiert. Es herrscht kein Diskurs über die Thematik «Rassismus an Schulen». Die Schweizer Volksschulen werden als ein «Ort für alle» idealisiert. Würde man jetzt sagen, «wir haben ein Problem», würde das dieses ideologische Konstrukt ins Wanken bringen. Hinzu kommt, dass es in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, kaum Forschung zu Rassismus an Schulen gibt, daher können wir das Problem auch nicht an die Politik herantragen. Auch an den relevanten Ausbildungsorten, wie z.B. den Pädagogischen Hochschulen, ist das Thema nicht verankert. Ich denke, viele Lehrpersonen und Schulleitungen wollen gegen Rassismus vorgehen, wissen aber nicht wie. Sie müssen hier von der Politik und auch von den Hochschulen unterstützt werden.
Wieso wird in diesem Gebiet so wenig geforscht?
Die Rassismusforschung ist an Schweizer Universitäten und Hochschulen schlecht verankert, obwohl es viele Nachwuchswissenschaftler*innen gibt, die sich der Thematik annehmen wollen. Rassismus wird oft als Randthema abgetan, weil, wie bereits erwähnt, man immer noch davon ausgeht, dass Rassismus etwas ist, das die Schweiz nicht tangiert. Die Forderung nach Rassismusforschung wird daher oft als ideologisch oder als ein Trend abgewimmelt. Es bräuchte in den sozialwissenschaftlichen Fächern Ressourcen, um diese Forschungslücke zu schliessen.

Dr. Stefanie Claudine Boulila ist Dozentin und Projektleiterin am Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern und Mitglied der Jungen Akademie Schweiz. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Gender, LGBTIQ-Lebensrealitäten, Rassismus und Intersektionalität. Sie ist Autorin der 2019 erschienenen Monographie «Race in Post-racial Europe» (Rowman and Littlefield International).
Sie sagen, dass Diskriminierung oft nicht auf individueller Ebene, sondern in einem institutionellen Rahmen stattfindet. Wie können Institutionen nachhaltig umgestaltet werden?
Zum Beispiel mit Aktionsplänen.
Was sind Aktionspläne?
Aktionspläne werden auf vielen verschiedenen politischen Ebenen genutzt. Es sind verbindliche Mittel, welche z.B. Kantonen oder Gemeinden, aber auch Institutionen zur Verfügung stehen, um beispielsweise Ungleichheiten in Schulen zu bekämpfen. Eine Hochschule könnte zum Beispiel auch einen Aktionsplan verabschieden.
Werden solche Pläne bereits verwendet?
Ja. Im Kanton Waadt gibt es beispielsweise den Aktionsplan gegen Homo-und Transphobie an Schulen. In diesem Aktionsplan geht es konkret darum, Schulpersonen auf die Thematik zu sensibilisieren und Schulen zu einem sicheren Ort für geschlechtliche und sexuelle Minderheiten zu machen.
Das heisst, eigentlich wäre es relativ einfach, Schulen nachhaltig zu verbessern?
Es gäbe sicherlich Wege, um Ungleichheiten im Bildungsbereich konkret anzugehen. Ein Teil des Problems ist aber auch die Unterrepräsentation von rassifizierten und migrantisierten Menschen in Entscheidungspositionen. Die Rassismusforschung zeigt, dass es Personen, die nicht selbst rassistische und diskriminierende Erfahrungen gemacht haben, schwerer fällt, rassistische Muster in einem System zu erkennen. Hätten wir z.B. mehr Schulleiter*innen, Lehrer*innen oder Bildungspolitiker*innen, die solche Erfahrungen gemacht haben, dann hätten wir eine reichere Grundhaltung, die eben auch die Perspektive von Betroffenen spiegelt.
Was kann die Politik tun, um die Chancengleichheit im Bildungsbereich sicherzustellen?
Sie könnte zum Beispiel Aktionspläne für Schulen anordnen. Das Gute an Aktionsplänen ist, dass man darüber sehr konkrete Massnahmen umsetzen kann. Man könnte Fachpersonen, die in der Schule arbeiten, wie Lehrkräften, Schulleitungen, aber auch dem administrativen Personal, Weiterbildungen im Bereich Antirassismus ermöglichen. Auch könnte man konkret gegen Bildungsmaterialien mit rassistischen Darstellungen im Unterricht vorgehen und Schulen dabei unterstützen, Bildungsmaterialien anzuschaffen, die Diversität abbilden. Zudem könnten auch Beschwerde- und Konfliktlösungsprozesse etabliert werden.
Wann kann man von einer echten Chancengleichheit sprechen? Können Sie uns ein Beispiel geben?
Ein Schweizer Beispiel, allerdings aus dem informellen Bildungsbereich, beziehungsweise der offenen Jugendarbeit, ist der Fachbereich Mädchen*arbeit des Trägervereins für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern. Orientiert an einem intersektionalen Ansatz, der sich auf feministische und antirassistische Prinzipien stützt, werden hier Mädchen, junge Frauen und nicht-binäre Personen bei Bildungsprozessen unterstützt, beraten und in partizipative Projekte eingebunden.
Herzlichen Dank für das Gespräch!