Artan Islamaj nahm an der Jahrestagung der Eidgenössischen Migrationskommission teil – und wurde enttäuscht. Ein Leserbrief.
Die Eidgenössische Migrationskommission lud am 8. November zur Jahrestagung in Bern ein. Im Zentrum des Anlasses stand die Frage: «Die Schweiz: eine Chancen(gerechte)-Gesellschaft für alle?» In Inputreferaten und einer Podiumsdiskussion zeigten die Referent*innen den status quo zur Chancengerechtigkeit auf, mit Blicken in die Vergangenheit und in die Zukunft. Im Fokus stand die Frage nach Chancengleichheit im Bildungswesen und die Integration in den Arbeitsmarkt von Kindern und Jugendlichen mit so genanntem Migrationshintergrund.
Laut eigenen Angaben fungiert die EKM unter anderem als Beraterin des Bundesrates und der Verwaltung in Migrationsfragen. Aufgrund dieser doch einflussreichen Position hatte ich bis anhin ein äusserst positives Bild dieser Kommission, auch weil sie mich als migrantische Person in der Schweizer Politik mitrepräsentieren soll.
«Durchgehend wurden Migrant*innen als fremd und defizitär bezeichnet (…).»
An der diesjährigen Jahrestagung wurden meine Erwartungen, vielleicht auch weil ich das erste Mal da war, jedoch schnell enttäuscht. Mit einer gewissen Irritation vernahm ich, dass einige der geladenen Fachexpert*innen Stereotypen von Migrant*innen reproduzierten und verfestigten. Dies mag, so sprach ich mir selbst gut zu, möglicherweise auf eine fehlende Sensibilisierung in Bezug auf Sprache in Migrationsthematiken aufweisen. Schnell merkte ich jedoch, dass die gebrauchte Sprache kongruent war mit der Art und Weise wie Menschen mit biographischen Migrationserfahrungen wahrgenommen werden.
Durchgehend wurden Migrant*innen als «fremd» und «defizitär» bezeichnet, in genannten Beispielen übten Migrantinnen stets den Beruf der «Putzfrau» (eine sensible Person hätte wohl «Reinigungskraft» gesagt) aus und Eltern von Schulkindern mit Migrationshintergrund wurden in den meisten Beispielen als weniger engagiert und ambitioniert, bildungsfern und eher armutsbetroffen dargestellt. Dies sind Begrifflichkeiten und Bilder, die im heutigen Diskurs durch ihren negativen und simplifizierenden Charakter als überholt gelten, zumal hier «Migrationshintergrund» mit «sozio-ökonomischen Status» gleichgesetzt wurde – und zwar tendenziell mit einem niedrigen.
Auch die Idee, durch Musterbeispiele von äusserst leistungsträchtigen Migrant*innen Erfolgsgeschichten der Schweiz zu zementieren, ist problematisch. So wurde die migrantische Community in zwei geteilt: jene, die unter jeglichen Bedingungen Leistung erbringen wollen und können, und andere, die dies nicht wollen. Letztere waren nicht nur negativ konnotiert, sondern wurden gleichzeitig (ab)gewertet, da eben erstere durch ihre Bemühungen auch wirtschaftlichen Nutzen für die Schweiz erbringen würden. Das grösste Risiko, das ein diskriminierendes Bildungswesen mit sich brächte, war nicht etwa Ungerechtigkeit, nein – es war die Belastung der Steuerzahlenden. Diese würden durch vermeintlich gescheiterte Migrant*innenkinder, ihre Bildungsbiographien und zweitklassige Integration in den Arbeitsmarkt also unnötig zur Kasse gebeten.
«Auch die Idee, durch Musterbeispiele von leistungsträchtigen Migrant*innen Erfolgsgeschichten der Schweiz zu zementieren, ist problematisch»
Diese doch sehr ökonomische Herangehensweise, die von vornherein Migrant*innen in «nützlich» (= müssen wir hier behalten) und «weniger nützlich (= faul = und nicht zwingend hier zu behalten) finde ich horrend. Migrant*innen sollten doch gerade von der EKM nicht anhand der Bewertung ihres ökonomischen Nutzens selektiert werden.
Als besonders herablassend und paternalistisch empfand ich den Gebrauch von Possessivpronomina, um von Personen zu sprechen, die man auf ihrem Bildungsweg in den Schweizer Bildungsinstitutionen unterstützt hat. Nein, ich möchte nicht «mein Migrant», «unsere Flüchtlinge» und «meine ausländischen Kinder» hören.
Auch die publik geteilten Anekdoten über besonders «rührende» Begegnungen mit unterprivilegierten Migrant*innen empfand ich und so auch andere Migrant*innen, die im Raum unterrepräsentiert waren, als sehr befremdlich, wie Gespräche mit diesen beim anschliessenden Apéro ergaben. So beispielsweise die pathetische Geschichte über eine Gruppe migrantischer Jugendlicher, die innerhalb der Bildungsinstitutionen als «verloren» galten, aber «rührend» waren, da sie bei einer Zusammenkunft spontan zusammen zu singen begannen, so schön, dass der Erzählerin das Herz aufgegangen sei.
Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist nichts falsch daran, singende Migrant*innen als rührend zu empfinden. Es ist das «trotzdem», das mich stört. Sie waren rührend, obwohl sie eigentlich verloren waren. Zwar verloren, aber immerhin sangen sie schön, mit so viel «Temperament» und «Herzblut», zum Amusement der privilegierten Erzählerin. Migrant*innen erscheinen nur dann wichtig, wenn sie der Mehrheitsgesellschaft einen Nutzen, hier Unterhaltung oder Zugang zur eigenen Emotionalität, bieten können. Dies sehe ich insbesondere deshalb als problematisch, weil darauf wieder Wortlaute wie «ausländisch» und «fremdsprachig» folgten – was das denn genau heisst und welche Implikationen solche Worte haben, wurde nicht weiter erläutert oder hinterfragt.
«Migrant*innen erscheinen nur dann wichtig, wenn sie der Mehrheitsgesellschaft einen Nutzen (…) bieten können.»
Zwei Lichtblicke gab es dann doch, nämlich Mark Terkessidis (Autor und Kolonialismus- und Migrationsforscher) und Elke-Nicole Kappus (Leiterin der Stabsstelle Chancengerechtigkeit der PH Luzern), die beide in ihren Inputs differenziert, sensibel und reflektiert auftraten. Ihnen gelang es, wichtige Herausforderungen, die sich aus der Migration ergeben, zu thematisieren ohne eine paternalistische Sprache zu benutzen. Dieser Eindruck hat sich in Gesprächen mit beiden nach dem Event noch bestärkt. Ihre Mitwirkung an der Tagung machte mir Hoffnung. Die beiden zeigten mir, dass die Art und Weise, wie wir über Migrant*innen sprechen, wertschätzend sein kann, und an der prekären Situation vieler Menschen mit Migrationshintergrund Anteil nehmen kann, ohne sie zu wandelnden Mangelwesen zu degradieren.
Ich habe Hoffnung, dass meine wohlwollende Kritik zur EKM gelangt und so doch eine explizite und fundamentale Änderung herbeiführt, sei es im Booking von Gästen oder allgemein in der Sprache und Sensibilisierung zum Thema Migration. Es ist vor allem die defizitorientierte Sprechweise, ein scheinbar noch sehr präsentes Überbleibsel der tradierten Migrationsforschung- und arbeit, welche es zu überwinden gilt.
«An der Jahrestagung wurde viel über Migrant*innen gesprochen und nicht mit ihnen.»
Aber auch das Line-Up war aus verschiedenen Gründen nicht optimal: es waren vor allem Leute dabei, die nicht sensibilisiert sind (oder dies zumindest nicht so ausdrücken konnten). So sehr ich das langjährige Engagement aller Referent*innen schätze, so sehr möchte ich darauf hinweisen, dass vielleicht auch gerade das der Grund dafür war, dass neuere und progressive Perspektiven keinen Eingang in die inhaltliche Gestaltung der Tagung fanden. Es wäre nicht nur ein mutiges, sondern auch die Wirklichkeit besser abbildendes Zeichen, wenn auch jüngere Stimmen bei der nächsten Tagung Raum erhielten.
Aber nicht nur entlang der Achse von «Alter», sondern auch dem migrantischen Vorder- und/oder Hintergrund gibt es Verbesserungsmöglichkeiten: Migrant*innen sollten in ihrer Vielfalt sichtbarer sein, sei es in den angeführten Beispielen von Menschen oder als Teil der eingeladenen Referent*innen. An der Jahrestagung der EKM wurde viel über Migrant*innen gesprochen und nicht mit ihnen; und noch weniger kamen wir selbst zu Wort.
Eine Fachtagung soll keine Betroffenheitsparade sein und ich spreche Menschen ohne Migrationshintergrund nicht ab, dass sie solide Forschung zur Lebensrealitäten von Migrant*innen leisten können. Aber es hätte ein symbolpolitisches Zeichen gesetzt, wenn auf der Bühne auch Migrant*innen auch als achtenswerte Expert*innen präsent gewesen wären – nicht bloss als bemitleidenswerte Putzfrauen in Beispielen.
Ich hoffe, dass meine Kritik gehört wird und bin aber auch zuversichtlich, dass durch solche Interventionen die EKM als etablierte Institution aktiv für eine progressivere, inklusivere und intersektionalere Schweiz einstehen und diese auch mitgestalten wird.


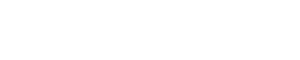
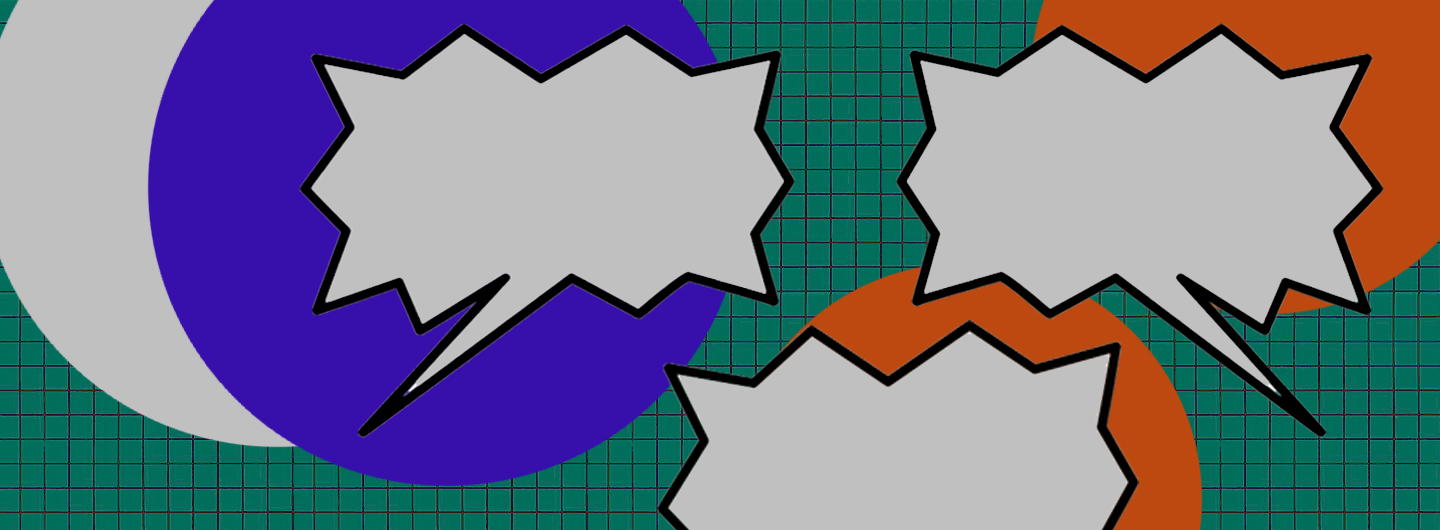
Hallo Artan — was für ein fundierter und detaillierter Erfahrungsbericht du geschrieben hast! Ich bin unheimlich gespannt, ob deine Worte Anklang fanden und es wäre noch viel spannender zu sehen, ob das Komitee vor hat das Framing und die Sprache zu optimieren! Würde mich gerne beim nächsten Treffen selber davon überzeugen…
Alles Gute
Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag!