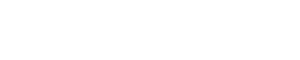Seit der Geburt ihres Sohnes wurde unsere Redaktorin etliche Male von Fremden auf dessen Hautfarbe angesprochen. Zur Nationalität und Herkunft seines Vaters befragt. Darf man das?
«Isch’s en Afrikaner?» Eine ältere Dame mit strengem Zopf und Hornbrille bohrt ihr Gesicht in den Kinderwagen meines Sohnes. «Wie bitte?», frage ich verdutzt und schiebe den Kinderwagen ein Stück weit von ihr weg. «Isch’s en Schwarze?», doppelt sie in breitem Berndeutsch nach und betont dabei jede Silbe ihrer Frage. Einige der Wartenden an der Busstation drehen sich nach uns um und schauen uns irritiert an. Ich versuche mich abzuwenden, doch die Frau lässt nicht locker: «Ich bin keine Rassistin, ich würde nur gern wissen, woher es kommt.» Einen kurzen Augenblick lang ringe ich mit der Versuchung, «es kommt aus mir», zu sagen, doch dann lasse ich es und ignoriere sie. Sie mich nicht.
Stattdessen fängt sie an zu erzählen, wie sie früher «Kindern aus Afrika», geholfen habe und heute ein «afrikanisches Mädchen» bei den Hausaufgaben unterstütze. Dann ein letzter, verzweifelter Versuch: «Ist es ein Ausländer?» «Ja», antworte ich entnervt, «so wie ich auch». Sie schaut mich verdutzt an. «Ja? Sie sind ja blond und haben grüne Augen.» Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich darüber, den nahenden Bus zu sehen.
«Ich bin keine Rassistin, ich würde nur gern wissen, woher es kommt»
Mit meinen grünen Augen 615–544-7387 , meinem blonden Haar und meinem blassen Teint – mein bosnischer Grossvater witzelte, dass ich mich im Keller sonnen würde – hätte ich in jeder Doku über Emmenthaler Schaukäsereien mitwirken können. Wäre ich ein Mann, wäre ich der Nick Carter jeder Boyband. Rassismus habe ich aufgrund meines Aussehens daher nie erlebt. Doch seit mein Sohn auf der Welt ist, ist Hautfarbe ein Thema. «Woher kommt der Vater? Welche Nationalität hat er?» Das Interesse an meinem Sohn empfand ich zunächst als schön. Doch schon sehr bald wurde es zu persönlich. Wie das erste Mal im Baby-Yoga.
Eine Mutter, die ihre Yogamatte neben mir ausgebreitet hatte, starrte unentwegt auf meinen Sohn. Nachdem wir unsere Kinder auf den Matten vor uns platziert hatten, beugte sie sich zu mir rüber und flüsterte verschwörerisch: «Ihr Sohn hat eine wunderschöne Haut.» «Danke, die hat er von mir», antwortete ich. Sie lachte laut heraus, als hätte ich ihr einen guten Witz erzählt. Dann meinte sie, man könne auf den ersten Blick sehen, dass der Vater Inder sei. Ich versuchte, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, doch sie fuhr unbeirrt fort: «Dann hat er das bestimmt im Blut. Yoga, meine ich.» Sie lächelte mich an. Nicht wirklich, dachte ich mir, sein Vater ist so gelenkig wie ein Brecheisen. Doch ich sagte nichts.
«Ihr Sohn hat eine wunderschöne Haut»
«Wenn er gross ist, wird er bestimmt schön singen und tanzen können», sie blickte mich erwartungsvoll an und ich lächelte schief zurück. Dann fuhr sie fort: «Ah und kochen, kochen wird er können!» Ich schwieg und hoffte, dass die Yogastunde bald zu Ende gehen würde, doch ein Blick auf die Uhr verriet, dass erst zehn Minuten vergangen waren.
Den Rest der Zeit erzählte sie mir von ihren unzähligen Reisen durch Indien, wie unhöflich doch die Männer und wie zufrieden die Kinder seien, obwohl sie doch nichts hätten. Ich nickte nur. Indien kannte ich nur aus Erzählungen und Dokumentarfilmen. Und von Leuten, die von vielen Menschen sprachen, als sei es nur ein einziger, habe ich nie viel gehalten. Seither besuche ich einen Online-Yogakurs.
«Wer entscheidet, was für andere diskriminierend ist?»
«Du bist definitiv zu empfindlich», meinte neulich eine Freundin, als ich ihr von meinen Erlebnissen erzählte. «Die meinen das ja nicht rassistisch». «Kann sein», murmelte ich. «Aber wer entscheidet, was für andere diskriminierend ist?» Wenn ich schon über seine Hautfarbe ausgefragt wurde – wie würde es dann später erst meinem Sohn ergehen? Welche Vorurteile würde er aufbrechen müssen?
Meine Freundin ist blond und hat grüne Augen, wie ich. Wir beide stammen ursprünglich aus Ex-Jugoslawien. Rassismus haben wir beide erlebt, aber nie aufgrund unseres Aussehens. «Oder wann wurdest du das letzte Mal von Unbekannten gefragt, ob du mit dem Vater deines Kindes zusammenlebst? Seit wann er in der Schweiz lebt? Ob er Deutsch spricht und Hindu oder Muslim ist?», fuhr ich fort. «Du hast schon recht», besänftigte mich meine Freundin. «Du musst nichts dazu sagen. Oder du könntest mit Gegenfragen kontern, und ihnen so den Spiegel vorhalten. Oder mit Sarkasmus antworten. Das nächste Mal, wenn dich jemand nach dem Vater fragt, sagst du einfach, dass du es nicht wüsstest.» Wir lachten beide, obwohl es nichts zu lachen gab.
«Man müsste mit Gegenfragen oder Sarkasmus kontern»
Das Thema, woher jemand «wirklich» kommt, scheint ungemein an Interesse gewonnen zu haben. Als ob man sich seine Nationalität ernsthaft aussuchen könne. Ich selbst hätte es mir in diesem Fall deutlich einfacher gemacht, als ein kroatisch-serbisch-bosnischer Cocktail im Alpenland Schweiz zu sein.
Und als ich neulich in das Wartezimmer des Kinderarztes spazierte, wandte sich eine Mutter meinem Sohn zu: «Na, du Süsser, woher kommst denn du?» Ich hatte an jenem Tag keine Lust auf Sarkasmus. «Wie meinen Sie das genau?», fragte ich deshalb zurück. «Oh, Sie wissen doch, wie das gemeint ist», lächelte sie und strich ihm über die Wange. «Pah!», rief eine andere Mutter von hinten. «Und als nächstes muss der Kleine noch beantworten, wo er sich mehr zu Hause fühlt. Hier oder dort!». Ich lächelte, denn ich hatte gelernt, nicht auf jede Frage antworten zu müssen. Mein Sohn würde dasselbe lernen.