Zum internationalen Tag der Roma hat sich Gastarbeiterin Lelia Ischi mit den zwei grösseren der drei Gruppen befasst, die oft im selben Atemzug genannt oder verallgemeinernd als «Fahrende» bezeichnet werden. Warum werden diese Minderheiten missrepräsentiert? Und wie sieht ihre Realität in der Schweiz aus? Eine Annäherung.
Es war einmal, da wurde ich als «Z‑Wort-Mädchen» verkleidet. Ich war etwa vier Jahre alt und spielte in einem Theaterstück mit, welches eine Freundin der Familie mit ihren Russisch-Studis auf die Beine gestellt hatte. Es wurden berührende «Z‑Wort-Lieder» gesungen und das «Z‑Wort-Leben» ganz nach Puschkins Manier dargestellt. Als Kind aus zwei Kulturen (tatarisch-russisch und schweizerisch), und die damit einhergehende «Parallelweltprägung», erfuhr ich früh die für bestimmte Teile Osteuropas typische Romantisierung und gleichzeitige Diskriminierung von Gruppen, die als «fahrende Völker» bezeichnet werden.
Von Freund*innen mit südosteuropäischem Hintergrund erhielt ich eine vage Vorstellung davon, dass diese Gruppen unter starker Diskriminierung in ihren Herkunftsländern litten. In der Schweizer Kultur schienen sie mir aber nie so richtig präsent. Und wenn, dann nur negativ – insbesondere die Roma. Ich glaube, dass ich schon erwachsen war, als ich zum ersten Mal von den Jenischen hörte. Und das, obwohl sie eine in der Schweiz einheimische Volksgruppe bilden.
Ich war schon erwachsen, als ich zum ersten Mal von den Jenischen hörte.
Die Schweizer Medienlandschaft schaffte es bis anhin nicht, diesen Gruppen gerecht zu werden. Stereotype, Pauschalisierungen und negative Fremdbilder sind noch immer die Regel. Studien aus 2013 und 2014 belegen den medialen Antiziganismus eindrücklich. Und nach wie vor finden Bezeichnungen wie das ausgeschriebene Z‑Wort oder «Fahrende» ihren Weg in die Artikel. Ich, in meiner Naivität, dachte, dass der Begriff «Fahrende» politisch korrekt sei, wenn man von «Jenischen, Sinti und Roma» spricht. Das Problem: Sie sind eben nicht alle «fahrend» – die überwiegende Mehrheit ist sesshaft.
Und die ständige «Bündelung» der drei Gruppen (unter denen noch zahlreiche weitere Untergruppen existieren) in «Jenische, Sinti und Roma» verzerrt genauso das Bild. Es sind unterschiedliche Minderheiten, deren Bedürfnisse sich teils überschneiden. Sie unterscheiden sich aber wesentlich in ihrer Geschichte, ihrer Kultur und Sprache, Lebensweise und ihrem Status in der Schweiz. Höchste Zeit also, ihnen zu begegnen, nachzufragen und über die Vorurteile hinauszusehen, die von den Schweizer Medien bis heute ständig wiederholt werden.
«Den Mythos der Fahrenden haben die Westeuropäer geschaffen.»
«Obwohl die Herkunft der Jenischen nicht gänzlich geklärt ist, sind sie als einheimische Volksgruppe anzusehen», erklärt mir Stéphane Laederich, Direktor der «Roma Foundation». Die Jenischen seien, zusammen mit den Sinti, seit 2016 als nationale Minderheit anerkannt. In der Schweiz leben um die 35’000 Jenische, von denen etwa 10% «fahrend» oder «reisend» sind. Das widerlegt bereits das erste Vorurteil. Genauso nur «vermeintlich fahrend» sind die Roma – 12 Millionen in Europa, wovon in der Schweiz zwischen 80’000 und 100’000 leben. Auch hier ist die grosse Mehrheit sesshaft und nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz nicht. «Roma waren als solches nie fahrend – überall, wo sie es konnten, haben sie sich niedergelassen», so Stéphane Laederich zur Migration der Roma aus Indien nach Europa im Mittelalter.
Die Mobilität sei vor allem durch die von den Roma ausgeübten Tätigkeiten bedingt gewesen und dies vor allem im Sommer. So hätten sie beispielsweise im Zarenreich Russland Pferde an die Armee verkauft, und mehrere zehntausend Pferde findet man nun mal nicht vor der eigenen Haustür. Noch bis heute reisen Roma wegen ihrer Arbeit, was jedoch oft mit dem Nomadentum verwechselt wird. Im deutschsprachigen Raum wurden sie im Mittelalter vielerorts verteufelt und verjagt, weshalb auch die Sinti ihren Wohnort ständig wechseln mussten. Sie waren also zum «Reisen» gezwungen. Dies wirkte sich wiederum negativ auf ihre Wahrnehmung durch die ansässigen Gesellschaften aus. Laederich fasst zusammen: «Den Mythos der Fahrenden haben die Westeuropäer geschaffen.»
Auch Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse (Dachorganisation der Jenischen und Sinti in der Schweiz), lehnt den Begriff «Fahrende» bezüglich der Jenischen ab. «Sie haben uns alle möglichen Namen gegeben», so Huber, «und fahrend ist für mich heute jeder Rollschuhclub.» Man solle sie klar benennen – ob es nun Jenische, Sinti oder Roma seien. «Es erstaunt, dass das Unwissen in der Bevölkerung noch immer so gross ist», so Huber, denn zwischen 1926 und 1973, als im Rahmen des Projekts «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» den Jenischen gezielt Kinder weggenommen und fremdplatziert wurden, habe man genau gewusst, um wen es sich handelte. Und dass mehr Menschen das Lied «Lustig ist das Z‑Wort-Leben» kannten als die richtigen Bezeichnungen, sei schlichtweg befremdlich. «Ich treffe heute noch auf Ablehnung, wenn ich mich als jenisch vorstelle», so Huber. Doch warum haben diese uralten und überwiegend negativen Fremdbilder bis heute überlebt?
«Die einzigen Roma, die als solche wahrgenommen werden, sind die, die den Stereotypen entsprechen.»
Für die scheinbare Unsterblichkeit der Vorurteile sieht Laederich drei zusammenhängende Ursachen: Erstens, die einzigen Roma, die als solche wahrgenommen werden, sind die, die den Stereotypen entsprechen. Dass die grosse Mehrheit weder stiehlt noch bettelt, sei nicht im Bewusstsein der Gesellschaft verankert. Zweitens: Diese Fälle werden von den Medien überproportional bearbeitet und pauschalisierend dargestellt. Und drittens entsteht durch diese Stigmatisierung der Umstand, dass sich die allermeisten Roma nicht als solche outen. Sie wissen, mit welchen Reaktionen zu rechnen ist. So bleibt die grosse Mehrheit, die unauffällig lebt, unsichtbar, und der Kreis schliesst sich.
Laederich zur Darstellung in den Medien: «Wenn Journalisten das Wort ‹Roma› in ihren Artikeln durch ‹Juden› oder irgendeine andere Minderheit ersetzen würden – würden sie diese dann noch immer publizieren?» Für ihn ist klar, dass mit vielen anderen Minderheiten mittlerweile vorsichtiger umgegangen würde, auch wenn da ebenfalls noch Handlungsbedarf bestehe. «Aber bei den Roma ist die fehlende Differenzierung die Regel.»
Dass in den Medien von negativen Einzelfällen auf alle Jenischen, Sinti und Roma – ob «fahrend» oder nicht – geschlossen wird, betont auch Huber: «Wenn dein Nachbar im Mehrfamilienhaus sich etwas zuschulden kommen lässt, bist du nicht schuld daran. Bei uns ist das aber so! Es heisst dann immer ‹Fahrende haben…›» Seit obengenannten Studien zum Antiziganismus in den Schweizer Medien habe sich nichts getan. Tatsächlich gab es in der Schweiz Medienberichte, die nach EU-Norm klar gegen das Gesetz verstossen hätten, während der Presserat und die schweizerische Antirassismus-Gesetzgebung durchlässiger sind. Die vom Antiziganismus betroffenen Gruppen teilen die Ansicht, dass sich die Schweiz in Hinblick auf die Strafverfolgung von Rassismus der EU-Norm anpassen sollte.
«Wännder es neus Schwümmbad oder wännder en Platz fürd Z‑Wort?»
Gemäss Huber wirkt sich auch die Konkurrenz unter den Gruppen um die Wagenplätze in der Schweiz auf die negative Darstellung aus. Die Knappheit der Plätze ist aber auch ein grundsätzliches Problem des Lebensraumes, der 2016 den Jenischen und Sinti durch die Anerkennung als nationale Minderheiten vom Bund zugesichert und nach wie vor nicht umgesetzt wurde. Das Scheitern der Umsetzung sei der Schweizer Föderalismus-Mühle zuzuschreiben, denn die Entscheidung über einen Wagenplatz wird auf Gemeindeebene gefällt.
Durch die Unkenntnis der Bevölkerung und den vorherrschenden Argwohn gegenüber den Nicht-Sesshaften werden neue Plätze bei Gemeindeabstimmungen meist abgelehnt. Dies auch weil oftmals die Frage zu einem Entweder-Oder verkommt. Stehe die Frage «Wännder es neus Schwümmbad oder wännder en Platz fürd Z‑Wort?» im Raum, so sei der Ausgang der Abstimmung zu Ungunsten der Jenischen, Sinti und Roma garantiert.
Dass der Staat in der Pflicht wäre, ausreichend Plätze zu schaffen, fällt dann meist unter den Tisch, wenn die Konkurrenz um die raren Plätze zu Skandalen hochstilisiert wird. Diese Sicht teilt Laederich mit Huber. Weiter führt Huber aus, dass die Angst vor Jenischen am eigenen Wohnort unberechtigt ist, denn «der Jenische sei der am besten kontrollierte Schweizer». Für ihre mobile Arbeitsweise brauchen sie Gewerbepatente, dafür wiederum einen einwandfreien Leumund. Um auf den Plätzen Halt zu machen, müssen sie sich bei der Gemeinde oder der Polizei anmelden, und die Plätze werden polizeilich kontrolliert.
«Der Jenische ist der am besten kontrollierte Schweizer.»
Der Argwohn der Bevölkerung wirke aber auch bis in die Vereinbarungen mit Privatpersonen: Wenn ein Bauer Jenischen erlaube, auf seinem Grundstück zu halten, komme es oft vor, dass dies von anderen Anwohnern nicht toleriert wird, und die Bauern unter sozialem Druck stehen, ihr Grundstück nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Der zur Verfügung stehende Lebensraum der Jenischen, die, um ihrer Arbeit nachzugehen, unterwegs sind, ist darüber hinaus selten an angenehmen Orten – beispielsweise in der Nähe einer Kläranlage oder bei lärmigen Flugplätzen.
Immer wiederkehrende Einwände wie «ihr müsst ja nicht hier sein» oder «warum geht ihr nicht auf einen der vielen, schönen TCS-Campingplätze?» sind für Huber haltlos. Denn was auch Laederich mehrfach betont, und was oft vergessen geht: Diese Menschen reisen, um zu arbeiten. Huber pointiert: «Stell dir vor, ein Jenischer geht seiner Arbeit auf einem Campingplatz nach, wo sich die gestressten Sesshaften in den Ferien erholen wollen, und er schleift nebenan die Messer seiner Kunden». Dieses Szenario wäre für keine der Beteiligten angenehm.
Die Skepsis und die damit verbundenen Vorurteile der sesshaften Mehrheitsbevölkerung kann man nur durch Begegnungen und das gegenseitige Kennenlernen abbauen. Laut Huber weisen bereits die Zäune rund um die Wagenplätze auf die Schranken zwischen Sesshaften und Nicht-Sesshaften hin. «Warum müssen um die Plätze herum Zäune sein? Man könnte die Plätze ja auch mit Blumenbeeten abgrenzen. So wie jetzt kommt ja keiner über den Zaun und ins Gespräch», erklärt er das Sinnbild, das sich in diesem Beispiel materialisiert.
«Mein Wunsch ist, dass irgendwann niemand mehr fragen muss: Was isch än Jänische?»
Die Radgenossenschaft der Landstrasse betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um die Vorurteile abzubauen. Das Dokumentationszentrum in Zürich ist ein Teil davon und kürzlich ist in Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen ein Lehrmittel zu den Jenischen, Sinti und Roma erschienen. Dieses werde erfreulicherweise bereits nachgefragt. Die Minderheiten werden darin vorgestellt und auf ihre Eigenheiten hingewiesen – man behandelt sie in einem Buch, aber wirft sie eben nicht in einen Topf. Sein Wunsch ist, dass irgendwann niemand mehr fragen muss, «Was isch än Jänische?»
Negative Stereotype in der Gesellschaft, einseitige Medienberichterstattung und die prekäre Situation der Wagenplätze sind nicht alles. Blickt man in die Vergangenheit und beschäftigt sich mit dem «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», kann man sich das Kollektivtrauma der Jenischen nur ansatzweise vorstellen – fast jede Familie wurde Opfer dieses systematischen Versuchs, ihre traditionelle Lebensweise und damit auch sie als Gruppe und ihre Identität zu zerstören. Rund 600 Kinder wurden ihren Eltern entrissen. Die Geschichte der Roma kann man in einem Artikel nicht annähernd angemessen erläutern. Weit über die Schweizergrenze hinaus waren sie je nach Region seit dem Mittelalter Teil der Gesellschaft oder über Jahrhunderte diskriminiert. Doch auch die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart bergen Realitäten, die das idealisierte Bild der heutigen Schweiz beträchtlich ins Wanken bringen.
Huber berichtet von mehreren Fällen, in denen zuvor «fahrende» Jenische zur sesshaften Lebensweise übergehen wollten, und sich auf Wohnungssuche machten. Wie wir wissen, braucht man dazu oftmals einen Auszug aus dem Betreibungsregister. Obwohl die betreffenden Personen nie betrieben wurden, und ihre Auszüge keine Einträge hatten, erschien auf diesen der Vermerk «ist fahrend». Dieser Vermerk, der eigentlich nicht Teil der behördlichen Praxis sein sollte, taucht wohl punktuell auf – je nach Behörde und zuständigen Beamten. Doch in diesen Einzelfällen erschweren derartige Vermerke die Wohnungssuche erheblich, weil sie zu Misstrauen bei potentiellen Vermietern führen – und schlichtweg fehl am Platz und diskriminierend sind.
«Der letzte uns bekannte Fall einer Zwangssterilisierung in der Schweiz war in den Neunzigern.»
Als Laederich sagte: «Der letzte uns bekannte Fall einer Zwangssterilisierung in der Schweiz war in den Neunzigern», stockte mir der Atem. Er erzählte mir die Geschichte einer jungen Sintizze, die sich an die Roma-Foundation gewandt hatte, nachdem sie eine Fruchtbarkeitsabklärung vornehmen liess. Der untersuchende Arzt hatte sie wissen lassen, dass der Grund für ihre gescheiterten Versuche, schwanger zu werden, eindeutig eine operativ durchgeführte Sterilisation war. Vor dieser Abklärung war sie nur einmal im Krankenhaus gewesen – in den 1990ern. Im Alter von 16 Jahren war sie damals mit einer Blinddarmentzündung in ein Schweizer Universitätsspital gebracht worden. Laederich wollte den Fall aufklären. Sie machten den damals zuständigen Arzt ausfindig und rüsteten sich für eine Anklage. Doch die junge Sintizze kam der Aufklärung ihres eigenen Schicksals zuvor – sie nahm sich das Leben.
Trotz gesellschaftlichem Stigma, institutioneller Ungerechtigkeit und Fällen von äusserster Diskriminierung und Entmenschlichung gibt es sie noch. Die Jenischen. Die Sinti. Die Roma. In all ihren Besonderheiten. Was sie eint, sind die historischen und gegenwärtigen Ungerechtigkeiten, mit denen man ihnen mithilfe eines veralteten, falschen und verletzenden Bildes und Sammelbegriffs begegnet.
Doch wie behält man die eigene Kultur unter solchen Bedingungen bei? Wie pflegen die Roma ihre Traditionen, wenn sie wegen «uns» nicht wagen auszusprechen, wer sie sind? Das Ausleben der Kultur findet diskret im Privaten und im Familienkreis statt. Bei den Jenischen ist ein interessanter Trend zu beobachten: Die jüngere Generation entscheidet sich wieder vermehrt für die «fahrende» Lebensweise und Arbeit – entgegen allen Versuchen, die unternommen wurden, um sie zu assimilieren. Huber empfiehlt uns hierzu den Film «jung und jenisch», und lädt zur Erholung auf den Campingplatz Rania ein, den er in Graubünden als einen Ort der Begegnung führt.

hat eine Leidenschaft für Geschichte und Osteuropa. Als Kind einer tatarischen Mutter, die sie in der Schweiz zur Russin erzogen hat, fragt sie am liebsten nach Identität, Zugehörigkeit und dominanten Erzählungen.
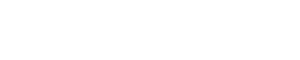


Toller augenöffnender Bericht!
Wow, danke für diesen spannenden Artikel! Ich habe schon jetzt mein Wissen verdoppelt und mich definitiv ertappt gefühlt bei diesen Vorurteilen.
Schöner Beitrag!
Bitte mehr davon