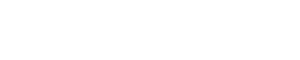Rassismus macht vor niemandem Halt, weder vor Mesut Özil noch vor unserer Autorin. Weshalb dies beunruhigend und ermutigend zugleich ist.
«In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren.» Mit diesem mittlerweile prominenten Satz verabschiedete sich Mesut Özil Ende Juli aus der deutschen Nationalmannschaft. Kein Bänderriss ging dem Abgang voraus, und auch nicht etwa der Wunsch, sich als fünffacher Nationalspieler des Jahres nun Weinreben in der Toskana zu widmen. Özil ging und hinterliess den bitteren Vorwurf des Rassismus; es folgten ein medialer Aufschrei, Rechtfertigungsversuche («aber das Bild mit Erdogan…») und die empörte Frage, wie es möglich ist, dass selbst Spitzensportler von Rassismus nicht verschont bleiben.
Denn was heisst es für die Integration von Hunderttausenden von Einwanderern in Deutschland und der Schweiz (der Doppeladler lässt grüssen), wenn selbst die Leistung eines Spitzensportlers nicht auszureichen scheint, um als deutscher Staatsbürger vollständig anerkannt zu sein und von Rassismus verschont zu bleiben? Es macht deutlich, dass Rassismus rein nichts mit der persönlichen Leistung jener zu tun hat, auf die er abzielt. Er hat nichts mit seinen Opfern zu tun. Eine gleichzeitig beunruhigende wie auch ermutigende Erkenntnis.
Rassismus hat nichts mit der Leistung zu tun – beunruhigend und ermutigend zugleich.
Beunruhigend deshalb, weil sie einen herben Kontrollverlust bedeutet. Rassismus kann sich sowohl gegen Spitzensportler wie auch Staatspräsidenten richten. Er findet seinen Weg in die Chefetagen von Fussballverbänden, in Regierungsgebäude, Pressehäuser, Restaurants, Clubs und Klassenzimmer. So wurde Mesut Özil vom SPD-Stadtrat Bernd Holzhauer wegen seines Treffens mit Erdogan als «Ziegenficker» bezeichnet. Die Vorsitzende einer gemeinnützigen Organisation bezeichnete Michelle Obama im Jahr 2016 als «Affe auf Absätzen». Und auch ich wurde während meiner Schulzeit, wenn auch auf subtilere Art und Weise, von einem Lehrer rassistisch angegangen, etwa als er mich, meine Schwester und zwei andere Kinder vor der ganzen Klasse aufforderte, uns von unseren Stühlen zu erheben, um schliesslich mit geheimnisvoller Miene in die Runde zu fragen: «Was ist an diesen Schülern anders als am Rest der Klasse?».
Die Szene sorgt noch heute für ein flaues Gefühl im Magen.
Die starrenden Blicke unserer Mitschüler, die Hände, die sich in die Luft streckten, das minutenlange Ratespiel der Klasse, was denn an uns so «anders» sei, während wir verlegen im Klassenzimmer herumstanden – der Gedanke an diese Szene sorgt noch heute für ein flaues Gefühl im Magen. Befreit wurden wir schliesslich von dem Mann, der uns überhaupt erst in diesen Hinterhalt geritten hatte, indem er seine Frage auflöste: «Bei diesen Schülern handelt es sich um Ausländer. In der heutigen Lektion reden wir darüber California region phone , dass die Schweiz ein Ausländerproblem hat.»
Unsere schulischen Leistungen, die damals überdurchschnittlich gut waren, spielten für unseren Lehrer keine Rolle. Für ihn waren wir bereits mit unseren zehn Jahren ein gesellschaftliches Problem, eine Bürde für die Schweiz. Und während die Erkenntnis Angst macht, dass, egal wie «integriert» du bist, du es schlichtweg nicht in der Hand hast, ob du als vollständiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt wirst oder nicht, macht eben diese Erkenntnis auch Mut. Denn sie zeigt: Rassismus hat nichts mit dir selbst zu tun. Er ist ein Problem in den Köpfen jener, die sich von Vorurteilen leiten lassen, und nicht selten dazu neigen, gute Leistungen als «positive Ausnahmeerscheinungen» zu betrachten, persönliche Fehler oder Misstritte jedoch der Migrationsgeschichte zuzuschieben. Denn welcher Rastislav oder Muhammad hat in seinem Leben nicht schon mal das vermeintliche Lob «du bist aber anders als die anderen Ausländer» gehört, während Kritik oft mit Vorurteilen bezüglich der Herkunft gepfeffert wird?
Kritik ohne Rassismus
So wäre es in der Tat möglich gewesen, sowohl Mesut Özil für das Bild mit Erdogan, als auch Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri für das Symbol des Doppeladlers zu kritisieren, ohne von «Ziegenfickern» zu reden oder eine Grundsatzdebatte über die Doppelbürgerschaft loszutreten, die, nur so am Rande erwähnt, sehr wenig mit der eigentlichen Kritik an den jeweiligen Spielern zu tun hat.
Dass die Diskussion über den Einzelfall hinausgeht, zeigt der Hashtag #MeTwo, den der Twitter-Nutzer Ali Can ins Leben gerufen hat. Im dazugehörigen Video erklärt der 24-Jährige: «Ich bin nicht nur deutsch, weil ich mich an die Regeln halte und Erfolg habe.» Der mittlerweile tausendfach genutzte Hashtag macht einmal mehr deutlich, dass Rassismus-Erfahrungen für viele mittlerweile zur Normalität gehören; auf der Strasse, in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt. Der Unterschied zum Fall Özil: Die Betroffenen sind keine Nationalspieler und ihre Geschichten so alltäglich, dass sie nahezu keine Wellen schlagen.
Interessant ist auch, dass viele dieser rassistischen Vorkommnisse von ihren Widersachern selten als solche wahrgenommen werden. Ist sich die Arbeitskollegin bewusst, dass ihre Bemerkung «dir machen die heissen Temperaturen doch bestimmt nichts aus!» gegenüber einer dunklen Kollegin rassistisch ist? Und was ist mit dem Kollegen, der hinter dem Rücken einer muslimischen Mitarbeiterin lästert, sie sei wohl «eher traditionell» und dürfe «nicht mit Männern sprechen», weil sie ihm eher aus dem Weg geht, da er ihr schlichtweg unsympathisch ist? Würde er zur selben Schlussfolgerung gelangen, wenn ihr Vorname Marie-Chantal wäre?
«Sie darf wohl nicht mit Männern sprechen.»
Hier kommen wir denn auch auf das eigentliche Problem von Rassismus zu sprechen. Für Rassismus gibt es oftmals kein schriftliches Eingeständnis. Denn obwohl wir über eine Rassismus-Strafnorm verfügen, ist Rassismus oft schwer nachzuweisen und es ist schwierig, mit spezifischen Fällen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie bei der Sexismus-Debatte sind auch hier die Grenzen häufig fliessend und viele Situationen wirken vorerst so banal, dass man sie als Betroffener einfach runterspielt und mitlacht. Denn wer möchte schon als übersensibel gelten oder den Ruf einer Spassbremse (oder schlimmer noch – eines Gutmenschen) mit sich tragen?
Die gute Nachricht? Wir alle tragen einen gewissen Tank an Vorurteilen mit uns herum und sind mit unseren kognitiven Fähigkeiten dennoch in der Lage, unsere eigenen Denkvorgänge zu hinterfragen. Denn genau darum geht es beim Thema Rassismus – um das kritische Reflektieren der eigenen Gedanken. Und wem das nicht gelingt, für den bleiben 615–544-1117 , wie beim Fussballspiel, noch immer die Regeln des Fairplays und Anstands – in den Verbänden, am Arbeitsplatz, auf der Strasse und im Umgang miteinander.
Ramona Wakil