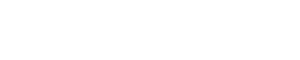An der U23-Europameisterschaft in Estland protestierte das Schweizer Fecht-Team auf ganz besondere Weise gegen die israelische Politik. Der Schweizer Fechtverband Swiss Fencing reagierte umgehend, entschuldigte sich bei der israelischen Delegation und betonte, dass sich sportliche Wettkämpfe nicht für politische Äusserungen eigneten. Dabei wurde Sport schon immer politisch genutzt – aber es ist sehr selektiv, was erlaubt ist.
Das Schweizer U23-Fechtteam verlor an der EM gegen Israel den Team-Final. Im Anschluss gratulierte das Team seinen Gegnern. Aber als die israelische Hymne gespielt wurde, drehten sich die Fechter aus der Schweiz, anders als die Teams aus Israel und Italien, nicht zur Seite in Richtung der israelischen Flagge.
Die Botschaft hinter dem Verhalten der Fechter ist klar: Es sollte gegen die Politik des Staates Israel protestiert werden und nicht gegen die betroffenen Sportler. Der Fechtverband Swiss Fencing reagierte umgehend, bezeichnete das Verhalten der Fechter als falsch und beklagte sich, dass sein Team die Siegerehrung für eine politische Manifestation missbraucht habe.
Dabei wird Sport regelmässig für politische Zwecke missbraucht, es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür: Sportswashing. Dieses wird immer dann betrieben, wenn ein Land sein eigenes Image mithilfe von Sportler*innen und Sportevents korrigieren will. Das bekannteste Beispiel ist Katar, welches nicht nur die WM 2022 ausrichtete, sondern auch den Fussballklub Paris Saint-Germain kaufte. Politik im Sport wird durchaus akzeptiert, solange im Gegenzug genug Geld an die Verantwortlichen fliesst.
Israels Sportler*innen dagegen müssen sich nicht von Netanyahus Politik distanzieren.
Umgekehrt kann der Sport aber auch politische Zeichen setzen, so wurden die meisten russischen Sportler*innen aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine von internationalen Anlässen ausgeschlossen. Ausnahmen gab es nur für solche Sportler*innen, die sich explizit gegen Putins Politik aussprachen – und somit ein politisches Statement setzten.
Israels Sportler*innen dagegen müssen sich nicht von Netanyahus Politik distanzieren. Dies, obwohl Israel vom Sonderausschuss der Vereinten Nationen, Amnesty International und zahlreichen renommierten Expert*innen vorgeworfen wird, einen Völkermord in Gaza zu begehen, der bisher über 50’000 Menschen das Leben gekostet hat. Es wird offenbar mit zweierlei Mass gemessen.
Die fristlose Entlassung wurde von einem Gericht nachträglich als unzulässig beurteilt.
Sportler*innen, die Kritik an Israels Politik äussern, müssen, im Gegenteil, mit Konsequenzen rechnen. Wie der niederländische Fussballspieler Anwar El Ghazi, der von seinem Klub FSV Mainz 05 entlassen wurde, weil er Solidarität mit den Menschen in Gaza gezeigt und dabei unter anderem die Parole «From the River to the Sea, Palestine will be free» geteilt hatte. Die fristlose Entlassung wurde von einem Gericht nachträglich als unzulässig beurteilt.
Im Fall der vier Schweizer Fechter hat sich der Verband Swiss Fencing umgehend distanziert, die jungen Sportler wurden von den Verantwortlichen einfach fallengelassen. Verbandspräsident Max Heinzer sagte gegenüber der NZZ: «Sie wollten sich ganz sicher nicht antisemitistisch äussern.» Als sei dies jemals der Fall gewesen.
Die Fechter haben sich gegenüber ihren israelischen Gegnern jederzeit korrekt verhalten, sie entschuldigten sich sogar direkt nach der Siegerehrung bei ihnen für den Protest. Der Protest richtete sich somit einzig und allein gegen den Staat Israel und dessen Politik. Das ist kein Antisemitismus, sondern eine legitime Kritik an einem völkerrechtswidrigen Vorgehen.
Es sind immer die gleichen israel-nahen Kreise, die die legitime Kritik an Israel als vermeintlichen Antisemitismus framen, und immer die gleichen Zeitungen übernehmen bereitwillig dieses Narrativ.
Aber die Reaktionen zeigen deutlich, wer sich an dieser legitimen Kritik stört. Die israelische Botschaft in der Schweiz und selbst der israelische Aussenminister äusserten sich zum Vorfall. Die Aargauer Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller empfahl dem Verband auf X, er «sollte seine Jungs in die Geschichtsnachhilfe schicken». Frau Binder-Keller ist übrigens Präsidentin der Freundschaftsgruppe Schweiz-Israel, eine Gruppierung, die Israels Positionen im Schweizer Parlament vertritt.
Es sind immer die gleichen israel-nahen Kreise, die die legitime Kritik an Israel als vermeintlichen Antisemitismus framen, und immer die gleichen Zeitungen übernehmen bereitwillig dieses Narrativ. Ein Blick in die Kommentarspalten der Instagram-Seiten der Athleten und von Swiss Fencing zeigt dagegen, dass die Mehrheit der Menschen den Protest durchaus richtig verstanden hat. Vielleicht wäre es deshalb mal Zeit, dass sich die Politik aus dem Sport heraushält.
Von Nico Zürcher